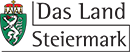Roter Stern über Graz. Zu den 75 Tagen sowjetische Besatzung 1945
Barbara Stelzl-Marx
„Wer wird uns besetzen? Russen, glaube ich, nicht”, vermerkt Hanns Hermann Gießauf noch am 8. Mai 1945 in seinem Tagebuch. Am nächsten Tag fügt der Grazer hinzu: „Und heute früh zwei Uhr kamen die Russen. In endlosen Kolonnen von Wagen, Autos und gummibereiften Kanonen.”[1] Diese Nacht, als Einheiten der 57. Armee der 3. Ukrainischen Front die steirische Landeshauptstadt vom NS-Regime befreiten und ohne Widerstand unter ihre Kontrolle brachten, markiert einen Wendepunkt in der Geschichte von Graz. Die einstige „Stadt der Volkserhebung” kommt für insgesamt elf Wochen unter sowjetische Besatzung, zum Schrecken eines Großteils der Bevölkerung, die mit den Briten gerechnet hatte. Einheiten der 8. „British Army” übernehmen erst im Zuge des Zonentausches am 23./24. Juli 1945 die Verwaltung der gesamten Steiermark. Doch diese kurze Phase hinterließ tiefgreifende Spuren: 75 Tage Roter Stern über Graz.

Neue Publikation zum Gedenkjahr 80 Jahre Kriegsende
Die Publikation „Roter Stern über Graz”, die hier kurz vorgestellt werden soll, ist vor dem Hintergrund des Gedenkjahres anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges entstanden.[2] Auf der Grundlage erstmals vertiefend ausgewerteter Archivdokumente, Zeitungsartikel und eigens durchgeführter Interviews mit 80 Personen, die als Kinder und Jugendliche diese dramatischen Nachkriegswochen erlebten, widmet er sich dem Grazer Alltag in diesem kompakten Zeitraum. Die tageweise Anordnung der einzelnen Kapitel, denen jeweils ein Typoskript einer Polizeimeldung vorangestellt ist, liefert ein Kalendarium sozialer, infrastruktureller, politischer, kultureller sowie persönlicher Herausforderungen und Veränderungen. Sie spiegeln den Ausnahmezustand wider, in dem sich alle Menschen während dieser ersten Nachkriegswochen befanden.
Als erzählerisches Sachbuch konzipiert, zieht sich die Perspektive von Johanna Herzog, der Dolmetscherin des sowjetischen Stadtkommandanten, als roter Faden durch den gesamten Text. Herzog soll als Identifikationsfigur einen möglichst unmittelbaren, lebendigen und vielschichtigen Einblick in den Alltag unter dem Roten Stern erlauben, gleichsam aus einer Sicht „von unten”. Zitierte O-Töne von Interviewpartnerinnen und -partnern, die sich mit einem zeitlichen Abstand von beinahe acht Jahrzehnten zurückerinnern, Zeitungsartikel und Ego-Dokumente untermauern diesen Zugang. Zur stärkeren Sichtbarmachung der Historizität und Authentizität wird bei zeitgenössischen Dokumenten daher auch einheitlich die alte Schreibweise herangezogen. Die folgenden aus der Publikation ausgewählten Passagen sollen einen Einblick in die elfwöchige sowjetische Besatzung von Graz geben.
Mittwoch, 9. Mai 1945: „Und heute früh zwei Uhr kamen die Russen”[3]
Gegen zwei Uhr in der Nacht wacht Johanna Herzog plötzlich auf. Ein Geklapper, das immer näher kommt und immer lauter wird, hat sie geweckt. Halb verschlafen überlegt die junge Grazerin zunächst, ob sie nur schlecht geträumt hat und weiterschlafen soll. Doch plötzlich ist ihr klar, was dies für ein Geräusch ist. Sie stürzt ans Fenster und blickt auf die überraschenderweise beleuchtete Straße hinunter: Sie sind da! Die „Russen” sind da! Nicht die Briten, auf die wohl die meisten gehofft hatten, sondern die „Russen”, wie die Soldaten der Roten Armee umgangssprachlich genannt werden.
„Und die Russen, die ersten Russen, die gekommen sind, sind mit Pferd und Anhänger, mit Pferdeanhängern, gekommen. Nicht [...] das motorisierte russische Militär ist gekommen, sondern die Kavallerie, mit Pferd und Wagen”.[4] „Und da war ein langer Zug, man hat nur dunkle Uniformen gesehen”, erinnert sich der 1941 geborene Peter Kahlen.[5] Das hört gar nicht mehr auf, denkt sich Johanna Herzog. Es kommt ihr vor wie eine Ewigkeit, als sie die langen Reihen beobachtet, die „mit Ross, mit den Pferden, mit den Anhängern, mit dem Fuhrwerk” in die Stadt hineinfahren.[6] Rund 20 Panzer sind über die im Nordwesten von Graz gelegene Riesstraße „heruntergerattert”, danach „tausende und abertausende Pferdewagen. Planenwagerl”, weiß Franz Ha.[7]

Dienstag, 22. Mai 1945: „Und damit hat es Erbsenpüree gegeben”[8]
Johanna Herzog kocht einen Sterz, wieder einmal, denn momentan gibt es in der Früh und am Abend nur diese Speise. „Und zu Mittag meistens ein Gemüse”, erinnert sich der 1931 geborene Johann Hütter.[9] Ein Glück, dass die junge Grazerin einen eigenen kleinen Garten hat und nun Mitte Mai Kohl, Kohlrabi oder auch ein paar Erdbeeren ernten kann.
Im Mai 1945 steht Graz knapp vor einer Hungerkatastrophe. Regelmäßig lässt sich der sowjetische Stadtkommandant Berichte über die Ernährungslage vorlegen, deren Ergebnisse niederschmetternd sind. Unter der Annahme einer Einwohnerzahl von 200.000 Personen beträgt der Bedarf etwa an Brot für vier Wochen 1680 Tonnen oder 60 Tonnen pro Tag bei einer Tagesration von 300 Gramm pro Person. Die vorhandenen Vorräte an Getreide umfassen 355 Tonnen, an Mehl 235 Tonnen, was nicht einmal für zwei Wochen reichen würde. Noch drastischer sieht es bei Fleisch aus: Für vier Wochen besteht ein Bedarf von mindestens 200 Tonnen, wobei lediglich 53 Rinder mit einer Höchstauswertung von rund fünf Tonnen sowie 18 Tonnen verschiedener Fleischwaren Mitte Mai vorrätig sind. Somit ist nur etwa ein Zehntel des Fleischbedarfes tatsächlich gedeckt.[10] Am 19. Mai gibt es keinerlei Vorräte an Zucker für den zivilen Bedarf mehr.[11]
Donnerstag, 31. Mai 1945: „Russische Soldaten schaffen die gesamten Werkzeuge weg”[12]
Die Flut an Meldungen, die Johanna Herzog von den einzelnen Grazer Polizeiposten tagtäglich entgegennimmt, hört nicht auf. Schnell übersetzt sie die manchmal auf Notizpapier getippten Texte und leitet sie an den Stadtkommandanten weiter. Sie erhielt dafür sogar eine eigene Schreibmaschine mit kyrillischer Tastatur aus den Beständen der Roten Armee. Die Meldungen betreffen nicht nur die – verbotenen – Plünderungen einzelner Rotarmisten, sondern auch Beschlagnahmungen und zunehmend Demontagen. Mit dem Zeitpunkt des Eintreffens in Graz in der Nacht vom achten auf den neunten Mai konfiszieren die Sowjets Lebensmittel, Fahrzeuge, Waffen, Gebäude und alles, was das materielle Leben der Stadt bieten kann. Allein für die Versorgung der Truppen müssten „Beutegüter und örtliche Möglichkeiten” in großem Maßstab genützt werden, heißt es lapidar in einem NKVD-Bericht zur allgemeinen Lage in Ostösterreich.[13]
Die damals 15-jährige Martha Huber erinnert sich etwa, wie sie Wagen „vollgeräumt mit Möbeln, Klaviere, alles Mögliche, die schönsten Möbel” gesehen hat. Diese waren allerdings im Freien, nicht zugedeckt, „und am nächsten Tag, wenn es geregnet hat, waren die Sachen hin. Und das ist alles abtransportiert worden. Wohin? Es kann nur Krempel mehr gewesen sein.” Die Grazerin betont: „Ich habe es selbst gesehen – uns hat das Herz weh getan.”[14] Das Ansehen der Roten Armee leidet enorm darunter.

Montag, 2. Juli 1945: „Fort mit dem nazistischen Namensschutt!”[15]
Die sowjetische Besatzungsmacht lässt nicht nur Stadtpläne mit kyrillischen Umschriften versehen, sondern stellt an markanten Plätzen und Kreuzungen auch russischsprachige Straßenschilder auf. Auf dem Bismarckplatz, jetzt Am Eisernen Tor, gibt es Wegweiser, „wo auf Kyrillisch die verschiedenen Richtungen angegeben sind, in denen man aus Graz herauskommen kann”, berichtet Karl Kubinzky.[16] Auch Gerd Weiß erinnert sich, wie er von einem Wegweiser auf dem Grazer Hauptplatz fasziniert war: „Und auf diesem Wegweiser ist natürlich alles in Kyrillisch draufgestanden. Aber mir wurde erklärt, da ist gestanden: ‚Moskau, soundso viele Kilometer‘.”[17]
Kürzlich ging Johanna Herzog sogar durch eine Straße, an der gerade die Schilder aus der NS-Zeit abmontiert und durch neue – beziehungsweise von der Bezeichnung her eigentlich alte – Tafeln ersetzt wurden. Wie schnell sich doch der Regimewechsel, diese Zeitenwende in der asphaltierten Erinnerungskultur niederschlägt, schoss es ihr durch den Kopf. Stürzen Regime, stürzen ihre Denkmäler, oder zumindest einige von ihnen. Ihr ist auch aufgefallen, dass in einer Anzeige vom 13. Mai der „Friedl-Sekanek-Ring” bereits wieder als „Opernring” firmierte.[18] Wenig überraschend hieß zudem der „Adolf-Hitler-Platz”, der beinahe zeitgleich mit dem „Anschluss” umbenannt worden war, besonders rasch wieder „Hauptplatz”. Franz Maria Kapfhammer schreibt dazu am 11. Mai 1945 in seinem Tagebuch: „Wir kamen zum Hauptplatz – gestern hieß er noch Adolf-Hitler-Platz.”[19] Wobei: Offiziell sollte der Gemeinderat die Umbenennung erst am 2. Juli 1947 beschließen.[20]

Montag, 9. Juli 1945: „Zur Abhilfe eines Notstandes”[21]
Ein noch größeres Tabu als Vergewaltigungen stellen Schwangerschaftsabbrüche dar.[22] Aus ihrer Arbeit in der Kommandantur und dem laufenden Kontakt mit der Grazer Polizei ist sich Johanna Herzog bewusst, dass viele Frauen erst dann eine Anzeige erstatten, wenn sie nach einer Vergewaltigung eine Abtreibung vornehmen lassen möchten. Vielfach liegen die Übergriffe daher schon mehrere Wochen zurück, ehe sie der Polizei gemeldet werden. Mitte Juli erstattet etwa Katharina P. die Anzeige, sie sei am 9. Mai in den Abendstunden im Hause Elisabethstraße 3, wo sie damals gewohnt habe, „vergewaltigt und angeschwangert [!] worden”.[23]
Grundsätzlich sind Schwangerschaftsabbrüche nach der im Juni 1945 wieder eingeführten Strafgesetzordnung, Paragraf 144, verboten. Jedoch hat die provisorische Steiermärkische Landesregierung bereits am 26. Mai 1945 „zur Abhilfe eines Notstandes” Abtreibungen nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus „ethischer Anzeige bei erwiesenen Notzuchtfällen” freigegeben.[24] An der Universitätsklinik Graz sollen zwischen 1. Juni und 30. Juli 1945 insgesamt 441 Abtreibungen durchgeführt worden seien.[25] Die tatsächliche Zahl ist sicherlich nach oben zu korrigieren, da viele Frauen erst nach dem 30. Juli eine Anzeige bei der Polizei erstatteten und in weiterer Folge einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen.[26]
Doch nicht alle Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung wurden, lassen eine Abtreibung durchführen. Gleiches gilt auch für jene Österreicherinnen, die als Folge einer Liebesbeziehung mit einem sowjetischen Soldaten schwanger wurden. So dürften auch in der steirischen Landeshauptstadt – wie in ganz Österreich – Nachkommen aus der gesamten Bandbreite sexueller Beziehungen zwischen Rotarmisten und einheimischen Frauen geboren worden sein. Wie viele es sind, lässt sich nicht eruieren. Klar ist jedoch eines: Viele der Besatzungskinder in Österreich litten ihr Leben lang unter Diskriminierung und Stigmatisierung. Etliche sind auch heute noch auf der Suche nach ihren Wurzeln väterlicherseits.[27]

Dienstag, 10. Juli 1945: „Die Russen waren bei Weitem besser als die Engländer”[28]
Gerade für die Armeeangehörigen, die durch den Krieg bereits lange ohne eigene Familie leben oder jene sogar verloren haben, ist der Kontakt zu österreichischen Kindern ein Versuch, an ein „normales” Leben anzuknüpfen. Nach einer so langen Zeit der Entbehrung und Not bedeutet dies ein zumindest partielles Wiederaufleben einer zivilen Existenz.[29] So notiert auch Franz Maria Kapfhammer in seinem Tagebuch am 13. Mai 1945: „Die Russen sind sehr kinderliebend. Immer wieder sieht man sie kleinen Kindern winken oder sie aufnehmen oder mit ihnen scherzen. In den Villen der Vorstädte sind sie einquartiert. Abends sitzen sie vor den Haustüren, kleine Kinder auf den Knien; ein unheimlich friedliches Bild.”[30] – „Die haben uns umarmt. Der eine Russe hat zum Weinen angefangen. Ich nehme an, der hat selbst zu Hause Kinder gehabt und Sehnsucht nach seinen Kindern. Die haben uns geliebt, die haben uns verwöhnt, gefüttert”, beschreibt Maria Buchhaus ihre Erfahrungen als vierjähriges Mädchen in Graz unter dem Roten Stern.[31]

Montag, 23. Juli 1945: „Und dann sind sie weg!”[32]
Nun sind sie weg, oder zumindest fast! Nach elf Wochen geht die sowjetische Besatzung von Graz und einem Großteil der Steiermark zu Ende. Es ist mitten in der Nacht, als Johanna Herzog aufwacht. Wieder ist sie von Pferdegeklapper und Stimmen vor ihrem Fenster geweckt worden – genauso wie vor elf Wochen. „Davaj, davaj!”, ist mehrfach zu hören. Rasch steht sie auf und blickt hinunter auf die Straße: Wieder ziehen Pferdefuhrwerke an ihr vorbei, voll beladen mit den unterschiedlichsten Utensilien, vieles davon aus Graz, nun allerdings in die entgegengesetzte Richtung. Auf den Wagen sitzen vier oder mehr bewaffnete Rotarmisten. Ihre braungrünen Uniformen sind ihr inzwischen vertraut, die Männer sehen weitaus besser aus als zu Kriegsende, natürlich etwas müde, aber bei Weitem nicht so abgekämpft.
Frau Herzog lässt die letzten 75 Tage Revue passieren. Viele Begegnungen fallen ihr ein, mit den unterschiedlichen Stadtkommandanten, die sich gerade in der ersten Zeit buchstäblich die Klinke in die Hand gegeben haben, mit dem Leutnant der Polizei Karl, mit dem sie wegen der laufend eintreffenden polizeilichen Meldungen über sogenannte Vorfälle in Kontakt war, mit Ludmilla, der Verkehrspolizistin, mit der sie sich etwas angefreundet hat. Nicht nur sie, die ganze Stadt beziehungsweise der größte Teil der Steiermark stehen „an einer Wende”.[33] Der Rote Stern über Graz ist untergegangen.
Anmerkungen
[1] Sammlung Graz Museum, Sammlungsbereich: Archivalien, Nachlass: Familie Gießauf, Tagebuch: Hanns Hermann Gießauf [in Folge: Tagebuch: Gießauf], 26. Die hier verwendete Schreibweise des Namens beruht auf der Schreibweise im Briefkopf von „Raumkunst Gießauf. Graz, Adolf-Hitler-Platz 14”. Siehe Tagebuch: Gießauf 55f. Der vorliegende Beitrag basiert auf meinen Ausführungen beim Wissenschaftlichen Kollegium der Historischen Landeskommission Steiermark am 14. Mai 2025 und auf der im Molden Verlag erschienenen Publikation Barbara Stelzl-Marx, Roter Stern über Graz. 75 Tage sowjetische Besatzung 1945 (Wien 2025) [in Folge: Stelzl-Marx, Roter Stern über Graz.]
[2] Stelzl-Marx, Roter Stern über Graz.
[3] Tagebuch: Gießauf 26. Am 12. April 1945 begann Hanns Hermann Gießauf unter dem Titel „Die schwersten Kriegstage" seine mit Zeitungsartikeln, Fotografien und Zeichnungen versehenen Tagebuchaufzeichnungen, die er bis zum 28. November 1946 führen sollte.
[4] Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung (= BIK), Oral History Interview (= OHI) Franz K. Durchgeführt von Alexander Karnowschek. Gratkorn, 10. 8. 2023.
[5] BIK, OHI Peter Kahlen. Durchgeführt von Alexandra Riemer. 9. 4. 2024.
[6] BIK, OHI Herbert Lammer. Durchgeführt von Alexandra Riemer. 5. 5. 2024.
[7] BIK, OHI Franz Ha. Durchgeführt von Alexandra Riemer. 5. 3. 2024.
[8] BIK, OHI Horst Staudacher. Durchgeführt von Alexandra Riemer. Graz, 14. 5. 2024.
[9] BIK, OHI Johann Hütter. Durchgeführt von Katharina Dolesch. Graz, 20. 9. 2023.
[10] Stadtarchiv Graz (= StAG), Anordnungen des russischen Stadtkommandanten, Bericht über den Lebensmittelbedarf der Bevölkerung von Graz, 16. 5. 1945. Vgl. Gerhard Marauschek, Die Grazer Stadtverwaltung im Jahre 1945/46. In: Graz 1945. Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 25 (1994), 161–180, hier: 168f.
[11] StAG, Anordnungen des russischen Stadtkommandanten, Niederschrift über die Besprechung zwischen dem Stadtkommandanten der Roten Armee von Graz und dem Staatssekretär für Volksernährung, 19. 5. 1945.
[12] Steiermärkisches Landesarchiv (= StLA), PD Graz, PK Graz, Meldung zur Papierfabrik in Andritz, 31. 5. 1945.
[13] Russisches Staatliches Militärarchiv (= RGVA), F. 32905, op. 1, d. 396, S. 63–66, Bericht des stv. Leiters der NKVD-Truppen zum Schutz des Hinterlandes der Truppen der CGV, Oberst Sacharov, über die Tätigkeit der Wirtschaftsapparate der NKVD-Truppen zum Schutz des Hinterlandes der Steppenfront und 2. Ukrainischen Front während des Krieges, 30. 9. 1945; Barbara Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich. Die Innensicht der sowjetischen Besatzung 1945–1955 (Wien–München 2012) [in Folge: Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich], 272.
[14] BIK, OHI Martha Huber. Durchgeführt von Katharina Dolesch. Graz, 18. 1. 2024.
[15] Auch dieser Schutt muss verschwinden. In: Neue Steirische Zeitung (31. 5. 1945), 2.
[16] BIK, OHI Kubinzky.
[17] BIK, OHI Gerd Weiß. Durchgeführt von Alexander Karnowschek. Graz, 10. 1. 2024.
[18] Steweag und EV. Süd. In: Grazer antifaschistische Volkszeitung (13. 5. 1945), 2; Alois Sillaber, Nomen est omen. Grazer Straßennamen als geistes- und ideologiegeschichtliche Quelle zum Jahr 1945. In: Graz 1945. Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 25 (1994), 643–663, hier: 654.
[19] Zit. nach: Günther Jontes/Günter Schilhan. Vom Anschluss bis zum Staatsvertrag. Die Steiermark 1938–1955 (Graz 2007) [in Folge: Jontes/Schilhan, Vom Anschluss bis zum Staatsvertrag], 91.
[20] Jennifer Matijak, E-Mail an Barbara Stelzl-Marx, 22. 1. 2025.
[21] StLA, BH Bruck, Grp. 12, K 435, 1945, Rundschreiben der provisorischen Steiermärkischen Landesregierung an alle Gesundheitsämter betreffend Schwangerschaftsunterbrechungen aus gesundheitlichen oder ethischen Gründen, 26. 5. 1945. Abgedruckt in: Stefan Karner/Barbara Stelzl-Marx u. a. (Hgg.), Die Rote Armee in Österreich Sowjetische Besatzung 1945–1955. Dokumente / Krasnaja Armija v Avstrii. Sovetskaja okkupacija 1945–1955. Dokumenty (Graz–Wien–München 2005), Dok. Nr. 118.
[22] Barbara Stelzl-Marx/Lena Wallner, „Um Hilfe wird gebeten.” Vergewaltigungen in Graz während der elfwöchigen sowjetischen Besatzung 1945. In: Demokratisierung in Graz seit 1945 – Anspruch und Realität. Historisches Jahrbuch der Stadt Graz. Band 53/54 (2025), 43–59 [in Folge: Stelzl-Marx/Wallner, „Um Hilfe wird gebeten”.
[23] StLA, PD Graz, PK Graz, Meldung über Vergewaltigung, 19. 7. 2945.
[24] StLA, BH Bruck, Grp. 12, K 435, 1945, Rundschreiben der provisorischen Steiermärkischen Landesregierung an alle Gesundheitsämter betreffend Schwangerschaftsunterbrechungen aus gesundheitlichen oder ethischen Gründen, 26. 5. 1945. Vgl. dazu auch Edith Petschnigg, Die „sowjetische” Steiermark 1945. Aspekte einer Wendezeit. In: Stefan Karner/Barbara Stelzl-Marx (Hg.), Die Rote Armee in Österreich. Sowjetische Besatzung 1945–1955. Beiträge (Graz–Wien–München 2005), 523–564, hier: 548; Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich 474f.
[25] Siegfried Beer, Das sowjetische „Intermezzo”. Die „Russenzeit” in der Steiermark. 8. Mai bis 23. Juli 1945. Joseph F. Desput (Hg.), Vom Bundesland zur europäischen Region. Die Steiermark von 1945 bis heute (= Geschichte der Steiermark 10, Graz 2004), 35–58, hier: S. 50.
[26] Lena Wallner, Polizeiakten erzählen: Vergewaltigungen unter sowjetischer Besatzung in Graz 1945 (MasterA Graz 2023), 69; Stelzl-Marx/Wallner, „Um Hilfe wird gebeten”.
[27] Barbara Stelzl-Marx, Kinder sowjetischer Besatzungssoldaten in Österreich. Stigmatisierung, Tabuisierung, Identitätssuche. In: Barbara Stelzl-Marx/Silke Satjukow (Hgg.), Besatzungskinder. Die Nachkommen alliierter Soldaten in Österreich und Deutschland (Wien–Köln–Weimar 2015), 93–135, hier: 104.
[28] BIK, OHI Gerhard Schmied. Durchgeführt von Alexandra Riemer. Graz, 16. 2. 2024.
[29] Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich 577.
[30] Zit. nach: Jontes/Schilhan, Vom Anschluss zum Staatsvertrag 92.
[31] BIK, OHI Maria Buchhaus. Durchgeführt von Alexander Karnowschek. Graz, 14. 10. 2024.
[32] BIK, OHI Franz H. Durchgeführt von Katharina Dolesch. Graz, 31. 3. 2023.
[33] An einer Wende. In: Neue Steirische Zeitung (24. 7. 1945), 1.
Univ.-Prof. Dr. Barbara Stelzl-Marx, geb. 1971 in Graz, studierte Anglistik, Russisch und Geschichte an der Universität Graz und in Oxford, Moskau, Wolgograd sowie an der Stanford University. Habilitation 2010, seit 2018 Leiterin des  Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung, seit 2019 Professorin für europäische Zeitgeschichte an der Universität Graz, 2020 „Wissenschafterin des Jahres". Mitglied der Historischen Landeskommission für Steiermark.
Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung, seit 2019 Professorin für europäische Zeitgeschichte an der Universität Graz, 2020 „Wissenschafterin des Jahres". Mitglied der Historischen Landeskommission für Steiermark.
Forschungsschwerpunkte: Kriegsfolgen des Zweiten Weltkrieges, Kinder des Krieges, Zwangsmigration und Kalter Krieg.