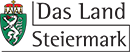„... zur Emporbringung der Kunst und zum Vergnügen des Publikums...“ – Die Gründung 1819 und das erste Inventar der Landesbildergalerie in Graz*
Karin Leitner-Ruhe
Von jeher ist überliefert, dass die Landesbildergalerie, Vorgängerinstitution der Alten Galerie und Neuen Galerie am Universalmuseum Joanneum, aus der ehemaligen Grazer Zeichenakademie hervorgegangen ist. Anfangs als Studiensammlung für die Zeichenschüler gedacht, wurde die Galerie 1819 zu einem bis vor kurzem nicht näher bekannten Datum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.[1]
Eine Anfrage an die Verfasserin aus dem Archiv der Akademie der bildenden Künste in Wien vor ein paar Jahren gab den Anstoß zu genaueren Recherchen. Dort befindet sich der Auszug eines Verzeichnisses, das (ohne Kenntnis der genannten Personen) weder datiert noch dezidiert lokal zuordenbar war. Betitelt ist es mit „Bildergallerie”.[2] Die Frage war, ob das Verzeichnis etwas mit Graz zu tun haben könnte und ob es sich tatsächlich auf die Zeit um 1820 beziehen kann. Nach genauerer Durchsicht dieses Verzeichnisses bestätigte sich die Annahme der Zuordnung zu Graz.
Damit tauchte die Frage auf, ab wann es die Bildergalerie in Graz tatsächlich gab bzw. wann diese öffentlich wurde.
Der Ursprung – Die Gründung der Zeichenakademie

Johann Veit Kauperz[3] (1741–1815) war Zeichner, Kupferstecher und Verleger in Graz. Er erfuhr seine erste Ausbildung bei seinem Vater Johann Michael Kaupertz (1712–1786) und setzte diese in Wien an der Kupferstecherakademie von Jakob Matthias Schmutzer fort. Im Laufe seines Studiums gewann er mehrere Preise und erhielt nach dem akademischen Abschluss 1773 vom Wiener Hof eine jährliche Dotation – allerdings mit der Auflage, sich in Wien aufzuhalten. Kauperz ging jedoch nach Graz zurück, um die Werkstatt seines Vaters zu übernehmen.
1774 richtete Maria Theresia in allen Hauptstädten sogenannte Normalschulen ein. Kauperz bewarb sich 1775 um eine Lehrstelle als Zeichenlehrer in Graz und wurde einer der ersten Zeichenlehrer Österreichs.
Da in der Normalschule das Zeichnen auf Arbeiten mit dem Lineal und dem Zirkel konzentriert war, Johann Veit Kauperz aber auch das Modellzeichnen nach Figuren bzw. das Landschaftszeichnen in der Natur lehren wollte, entschloss er sich 1785, eine eigene Zeichenakademie in Graz nach dem Unterrichtsstil der Wiener Kupferstecherakademie zu eröffnen. Er benötigte dafür die Unterstützung der Steirischen Landstände. Nach einer anfangs eher zögerlichen Finanzierung wurde ab 1791 ein jährlich festgesetzter Betrag von den Steirischen Ständen fixiert. Von da an kann man von einer „Steirisch Ständischen Zeichenakademie” sprechen. Der Direktor musste jährlich einen Bericht über das Unterrichtsjahr und die Schülerliste abgeben.
Die Unterrichtsstunden stellten sich aus Figurenzeichnen, Landschaftszeichnung sowie Baukunst und Perspektive zusammen. Das Figurenzeichnen wurde sowohl nach Gipsfiguren als auch nach dem Modell vorgenommen.
Es ist bekannt, dass Kauperz zumindest eine kleine Kunstsammlung besaß. Diese und üblicherweise Zeichnungen von ihm selbst könnten bereits für das Studium in der Zeichenakademie verwendet worden sein.
Die Protagonisten Josef August Stark (1782–1838) und Ferdinand Maria Graf Attems (1746–1820)
1817 wurde der klassizistische Historienmaler Josef August Stark (1782–1838) zum Akademiedirektor in Graz gewählt. Er hatte seine erste Ausbildung bei Kauperz in der Zeichenakademie erfahren und bildete sich danach in Wien an der Akademie der bildenden Künste unter Hubert Maurer, Franz Caucig und Johann Baptist Lampi weiter.
Stark bewirkte viele Neuerungen in der Grazer Zeichenakademie. Zwar orientierte er sich – wie sein Vorgänger Kauperz – hauptsächlich an der Ausrichtung der Wiener Akademie und legte einen Unterrichtsablauf nach sechs Jahrgängen fest, aber hatte Kauperz sich noch ganz auf das Zeichnen konzentriert, so führte Stark die Malerei in der Akademie ein. Parallel zu den Innovationen in der Akademie erbat Stark Gemälde als Leihgaben, die anfangs als Studienmaterial für seine Schüler dienten. Damit war der Grundstein für eine Bildergalerie gelegt. Stark nutzte ein umfangreiches Netzwerk in Graz und Wien. Er sammelte selbst und vermachte seine Kunstsammlung von rund 300 Gemälden nach seinem Tod 1838 der Bildergalerie.
Wie schon zur Zeit von Kauperz konnte ein Künstler eine Institution wie eine Bildergalerie nicht allein ins Leben rufen. Er brauchte vor allem einen Förderer aus den öffentlichen Reihen. Diesen fand er im kunstaffinen steirischen Landeshauptmann Ferdinand Maria Graf Attems. Erzherzog Johann hatte Attems bereits 1811 zum ersten Kurator und seinen Stellvertreter im neu gegründeten Joanneum ernannt. Die Attemsche Kunstsammlung sollte letztendlich ein wichtiger Baustein der Bildergalerie werden – bis heute.
Das Wildensteinsche Haus

1811 war die Zeichenakademie unter Kauperz in den Lesliehof in der Raubergasse Nr. 10 gezogen, wo das von Erzherzog Johann gestiftete „Innerösterreichische Nationalmuseum” Joanneum eingerichtet worden war. Da die vorwiegend technischen und naturwissenschaftlichen Sammlungen des Joanneums stetig wuchsen, wurde der Platz bald eng.
Mit der Planung einer Bildergalerie wurde 1818 von den Steirischen Ständen bewusst das sogenannte Wildensteinsche Haus in der Hans-Sachs-Gasse 1 [damals Neugasse 142] angekauft. Der dreigeschossige, fünfachsige Palaisbau war um 1690 vom Landeshauptmann Georg von Stubenberg erbaut worden.[4] 1691 verkaufte er ihn an Graf Michael Weikhart Vetter von der Lilie. Nach dessen Tod ehelichte seine Witwe 1709 Johann Josef Graf von Wildenstein, der um 1710 den charakteristischen Balkon mit den Atlanten ergänzte. Das Haus ist seitdem als das Wildensteinsche Haus bekannt.
In einem Bericht von Ferdinand Attems an Fürst Metternich am 15. Jänner 1820 wird die Raumaufteilung im Wildensteinschen Haus genauer erläutert: „Im ersten Stocke wurden die kleineren Zimmer zur Wohnung des Directors, und vier geräumige zur Zeichnungs-Schule verwendet, wovon eines zur Schule der Mädchen gewidmet ist, damit auch diese in Stickmustern und Blumenzeichnungen unterrichtet werden können.
Im zweyten Stocke wurden 8 lichte Zimmer zur Bildergallerie, wo es Jedermann frey stehet seine Gemählde zur Schau auszustellen, und welche ebenfalls so wie die Zeichnungs-Schule unter der Direction des Joseph Stark stehet, bestimmt.”[5]
Josef August Stark wird als erster Direktor der Bildergalerie genannt und führt die beiden Institutionen parallel.
Öffnungsdatum und Besichtigungszeiten
Eine Eröffnung wie heute üblich hat es damals nicht gegeben. Eine Kundmachung in der Grätzer Zeitung vom 15. März 1819 machte die Bevölkerung auf die neue Attraktion aufmerksam: „Bereits untern 22. Oktober 1818 wurde bekannt gemacht, daß die Herren Stände Steyermarks zur Emporbringung der Kunst und zum Vergnügen des Publikums den zweyten Stock des Zeichnungsacademie-Gebäudes in der Neugasse N:o 142 zu Grätz der Errichtung einer Bildergallerie gewiedmet haben. Da nun die nöthigen Herstellungen des Gebäudes vollendet, und die von mehreren Kunstfreunden zur Aufstellung abgegebenen Gemählde geordnet sind: so sieht man sich in die angenehme Lage versetzt, anzukünden, daß diese Bildergallerie vom 21. des gegenwärtigen Monathes März angefangen, wöchentlich zweymahl und zwar Sonntags von 11 bis 1 Uhr, und Donnerstags von 10 bis 12 Uhr Vormittags geöffnet, und Jedermann der Zutritt in dieselbe gestattet werden wird.”[6]
Erstaunlich sind die Besucherzahlen, die Ferdinand Attems an Metternich berichtet: „Auch wurde die Liebe zur Kunst so sehr erweckt, daß an den Einlasstagen schon mehrmahlen bey 400 Schaulustigen von allen Klassen der Menschen sich einfanden. In dem nemlichen Grade stieg auch die Neigung zur Kunst bey der hiesigen Jugend an, wovon das beyliegende Verzeichnis der Schüler und Schülerinnen den Beweis liefert.”[7]
Zeichenakademie und Bildergalerie bereicherten einander im Zulauf der Besucher und Besucherinnen.
Das erste Inventar
Das anfangs erwähnte Verzeichnis im Archiv der Akademie der bildenden Künste in Wien ist lediglich ein Auszug des ersten Inventars der Bildergalerie und nennt 320 Bilder. Wie sich durch die jüngsten Recherchen herausstellte, befindet sich das erste, heute noch erhaltene Inventarbuch im Archiv der Alten Galerie. Dieses umfasst die Nummerierung 1 bis 601 und umspannt die Eingangsdauer vom 15. September 1818 bis zum 30. Mai 1829. Bis zum Tag der Öffnung der Bildergalerie für die Allgemeinheit am 21. März 1819 gelangten 201 Gemälde in die Räumlichkeiten der Institution. Innerhalb eines halben Jahres war damit eine ansehnliche Präsentation zusammengestellt worden.
Die Bilder befinden sich in dieser Zeit nicht im Eigentum der Bildergalerie. Sie stammen von zahlreichen Leihgebern, die hauptsächlich aus dem Adel, aber auch künstlerischen Bereichen, der Beamtenschaft und wohlhabenden Bürgerkreisen kommen.
Welche Personen gaben Bilder in die Galerie?
Es waren insgesamt 25 Privatpersonen und zwei Institutionen, die Bilder aus ihrem Besitz für eine gewisse Zeit zur Verfügung stellten. Allen voran war es die Familie Attems, die sich mit insgesamt 106 Bildern beteiligte – die meisten kamen von Ignaz Graf Attems (56 Bilder), gefolgt von seinem Vater Ferdinand Graf Attems (38 Bilder) sowie seinem Bruder Franz Graf Attems (12 Bilder).
Der nächstgrößte Leihgeber war mit 31 Gemälden Direktor Josef August Stark selbst.
Zu den weiteren Leihgebern zählten unter anderen Johann von Kalchberg (5 Bilder), Vertreter aus dem Ritterstand und, ab 1811 als Kurator im Joanneum eingesetzt, der bürgerliche Maler Matthias Schiffer (2 Bilder), der Theaterdirektor in Graz Josef von Zambiaso (11 Bilder) und ein nicht näher bekannter Franz Rothe (27 Bilder), Handelsmann aus Böhmen. Erzherzog Johann vermittelte einige Gemälde wie z. B. das bekannte Parisurteil von Lucas Cranach. Neun Objekte kamen aus dem Joanneum in die Bildergalerie, womit auch ersichtlich ist, dass die Bildergalerie zu dieser Zeit nicht Teil des Museums war, sondern als eigenständige Institution agierte.
Der vorangestellte Text des Verzeichnisses im Archiv der Akademie der bildenden Künste in Wien erläutert jene Auflistung genauer, die wir heute als erstes Inventar verstehen: „[...] Ein zum unterrichtenden Gebrauche des Publikums bereit liegendes Verzeichniß enthält die Nummern der Bilder, den Gegenstand, das Maaß, den Autor, wo möglich die Schule und das Zeitalter, ferner den Eigenthümer, den Tag der Hineingabe, den der allfälligen Zurückgabe, und eine Rubrik für Anmerkungen. Die Gemälde selbst sind mit dem Katalog gleichlautend durch schwarze Nummern auf Goldgrund bezeichnet.”[8] Bemerkenswert ist hier schon der angesprochene Bildungsanspruch der Einrichtung. Man kann diesem Inventar das häufige Durchblättern deutlich ansehen – bis zu verlorenen Ecken. Deshalb entschied man sich Anfang der 1840er Jahre für Raumtafeln.
Man muss von einer für diese Zeit typischen, dichten Hängung, der sogenannten Petersburger Hängung, ausgehen. Ein System ist nicht ersichtlich. Werke von niederländischen, deutschen und italienischen Künstlern hängen gemeinsam in einem Raum. Die Themen sind vielfältig. Auch die Jahrhunderte werden vom 16. bis zum 19. vermischt nebeneinander präsentiert. Es ist zu vermuten, dass nach freiem Platz gehängt wurde, da Leihgaben immer wieder abgeholt und ersetzt werden konnten.
Diese Ausführungen zu den Anfängen der Bildergalerie konnten nicht mehr als eine Skizze sein. Eine ausführliche Publikation zu ihrer landesgeschichtlich und kunsthistorisch bedeutsamen Entwicklung ist seitens der Verfasserin bereits geplant.
Anmerkungen
* Die Ausführungen beruhen auf einem Vortrag, den die Verfasserin dieses Blogbeitrags am 14. Mai 2025 im Rahmen des Wissenschaftlichen Kollegiums der HLK gehalten hat.
[1] Vgl. Wilhelm Suida, Die Landes-Bildergalerie. In: Kuratorium des Landesmuseums (Hg.)/Anton Mell (Red.), Das steiermärkische Landesmuseum Joanneum und seine Sammlungen (Graz 1911), 349–381.
[2] Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste Wien, fol. 624-629 ex VA [Verwaltungsakten], „Auszug. Aus dem Catalog der ständischen Bildergallerie”. – Der Dank für die Zurverfügungstellung gilt Ulrike Hirhager, stellvertretender Leiterin des Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste Wien.
[3] Vgl. Karin Leitner, Johann Veit Kauperz (1741–1815). Kupferstecher und Gründer der Steirisch-Ständischen Zeichnungsakademie (Diss. Graz 1998). – Eine aktualisierte Publikation ist in Arbeit und soll 2026 erscheinen.
[4] Vgl. Wiltraud Resch, Die Kunstdenkmäler der Stadt Graz. Die Profanbauten des I. Bezirkes. Altstadt (= Österreichische Kunsttopographie Bd. LIII, Wien 1997), 146–149.
[5] Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste Wien, Metternich Registratur MR 1820, Bericht von Ferdinand Attems an Fürst Metternich am 15. Jänner 1820.
[6] Steyermärkische Intelligenzblätter. Beilage zur Grätzer Zeitung, Nr. 42 (15. 3. 1819), [3].
[7] Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste Wien, Metternich Registratur MR 1820, Bericht von Ferdinand Attems an Fürst Metternich am 15. Jänner 1820.
[8] Universitätsarchiv der Akademie der bildenden Künste Wien, fol. 624-629 ex VA [Verwaltungsakten], „Auszug. Aus dem Catalog der ständischen Bildergallerie”.
Mag. Dr. Karin Leitner-Ruhe, Studium Kunstgeschichte und Französisch an der Universität Graz, ab 1992 wissenschaftlicher Dienst in der Alten Galerie des Universalmuseums Joanneum, seit 2013 Chefkuratorin der Alten Galerie, 2003–2018 Restitutionsbeauftragte am Universalmuseum Joanneum und Mitglied im Arbeitskreis Provenienzforschung, Mitglied der HLK seit 2023.
Forschungschwerpunkte: Sammlungsgeschichte, Provenienzforschung, Graphische Sammlung sowie Kunst des Mittelalters in Österreich