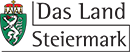Stadtarchäologie Graz – Eine Heimat für das archäologische Erbe der Stadt
Susanne Lamm
„Stadtarchäologie” fällt ein wenig aus dem Rahmen, wenn man an die gängigen Bezeichnungen archäologischer Disziplinen denkt. Diese haben zumeist ein zeitliches oder geographisches Attribut, etwa Klassische Archäologie, Provinzialrömische Archäologie, Neuzeitarchäologie, Vorderasiatische Archäologie etc. oder eine thematische Beschränkung wie Christliche Archäologie, Industriearchäologie etc. Der Begriff Stadtarchäologie bezieht sich hingegen auf einen eng definierten geographischen Bereich, das Gebiet heutiger Städte[1] ist aber sowohl zeitlich als auch thematisch breit gestreut. Graz sowie der Großteil der österreichischen und deutschen Städte geht zwar auf mittelalterliche Siedlungen zurück, aber es gibt auch (Haupt)Städte wie Wien und Sankt Pölten, die aus bekannten römerzeitlichen Siedlungen, Vindobona und Aelium Cetium, hervorgegangen sind. Und diese müssen nicht unbedingt „auf der grünen Wiese” gegründet worden sein, sondern können schon auf prähistorische Siedlungsplätze zurückgehen. Damit ist nun schon erklärt, warum stadtarchäologische Funde und Befunde eine derart große zeitliche Streuung aufweisen können, beginnend mit prähistorischen Vorläufern bis hin zu zeitgeschichtlichen Überresten aus dem 20. (und mancherorts auch 21.) Jahrhundert.
Auf Graz und seine Stadtarchäologie trifft die volle zeitliche Bandbreite zu: von prähistorischen Siedlungen und Gräberfeldern über römische Siedlungsspuren bis hin zur mittelalterlichen Stadt, neuzeitlichen Friedhöfen und den Resten von Zwangsarbeitslagern und Industrieanlagen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Die Überreste aus letzterer Zeitphase, namentlich dem ehemaligen Zwangsarbeitslager V Liebenau und dem Gelände der ehemaligen Brauerei Reininghaus, waren der Grund für die Einrichtung der Stadtarchäologie als Teil der Abteilung Sammlungen am Graz Museum im Dezember 2020[2]. Dabei erstreckt sich die Zuständigkeit auf Funde (und Befunde) von städtischen Liegenschaften.[3] Die mit Anfang März 2021 aufgenommenen Arbeiten (zuerst in einer alten Bellaflora-Halle, seit Juli 2024 in einem anderen Lagerhallenkomplex im Süden von Graz) umfassten zu Beginn primär die Lagerung und Sortierung der von den beiden Großbaustellen Murkraftwerk und Reininghausgründe angelieferten zeitgeschichtlichen Funde. Bis Jahresende 2021 waren das 842 Euronormboxen mit kleineren Funden und 17 freistehende Großfunde.
Herausforderung Massenfunde


Da es absehbar war, dass weitere zeitgeschichtliche Funde freigelegt werden würden, musste man sich der Frage stellen, wie man mit einer derartigen großen Anzahl (wir sprechen hier von mehreren Tonnen und zehntausenden Objekten) umgehen soll. Die Menge und der Zustand der vielfach gleichartigen Funde (welche Massenfunde genannt werden, da sie in industrieller Massenproduktion hergestellt wurden) zwangen aus konservatorischer und platztechnischer Sicht zu einem revolutionären Umdenken, was die Aufbewahrung von Funden anbelangt. Der damalige Leiter der Stadtarchäologie, Georg Tiefengraber, entwickelte gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen Björk Košir und Anna Zelenka in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt von 2021 bis zu seinem Ausscheiden im Juni 2022 einen den Vorgaben des Denkmalschutzgesetzes entsprechenden Kriterienkatalog[4] zur Teilaussonderung von „Massenfunden”[5]. Dieser Kriterienkatalog diente als Grundlage für die Bewertung der zehntausenden Einzelobjekte, die von den Reininghausgründen stammten. Es wurden dabei keine Objekte aus dem Bereich des Lagers Liebenau dieser Bewertung unterzogen, da der gesamte Fundplatz aufgrund seiner Geschichte als „historisch belastet” einzustufen ist.[6]
Björk Košir und Anna Zelenka bewerteten die Fundstücke von den Reininghausgründen und unterteilten sie in erhaltenswerte und auszusondernde Funde. Diejenigen Funde, die nicht einem der o.g. Kriterien entsprachen, wurden in einen Fundkatalog aufgenommen, vermessen, bestimmt und fotografiert sowie in eine eigene „Aussonderungsdatenbank” innerhalb der Museumsdatenbank M-Box eingetragen. Der Vorgang, bei dem mehr als 22.000 Objekte in die Datenbank aufgenommen wurden, dauerte rund ein Jahr.
Diese Funde wurden in einem weiteren Schritt, den ich als Nachfolgerin von Georg Tiefengraber ab dem 2. November 2022 mitausführen konnte, in mehreren Tranchen an das Bundesdenkmalamt mit dem Ansuchen um Zerstörung nach § 5 DMSG übermittelt. Es folgten daraufhin mehrere Termine mit Eva Steigberger und Jörg Fürnholzer (beide Abteilung für Archäologie am Bundesdenkmalamt), um die zur Aussonderung vorgeschlagenen Objekte durchzugehen und zu überprüfen, ob die getroffenen Entscheidungen, basierend auf dem Kriterienkatalog, korrekt waren; bis auf wenige Ausnahmen war dies auch der Fall. Am 11. Dezember 2023 konnten schließlich 438 Kisten und 3 Paletten mit Großfunden, etwa 2/3 aller damaligen Funde von den Reininghausgründen mit einem Gesamtgewicht von 5,1 Tonnen (vorwiegend Altmetall), entsorgt werden.
Dieser Prozess der Kategorisierung, Dokumentation und schlussendlich Zerstörung von archäologischen Funden nimmt dabei eine Pionierrolle im mitteleuropäischen Raum ein. Erst durch die Auseinandersetzung mit den vor Ort entdeckten Massenfunden konnte hier erstmals eine Vorgehensweise erarbeitet werden, bei der Funde nach ihrer Dokumentation zerstört wurden, da eine dauerhafte Aufbewahrung aus ressourcentechnischen Gründen[7] nicht möglich war. Analog zu den Grazer Fundkategorisierungen fanden auch solche bei den Grabungen in der ehemaligen SS-Kaserne in Linz-Ebelsberg[8] statt – hier wurden (Metall-)Funde schlussendlich eingeschmolzen. Möglich wurde dies aber erst durch die Grazer Vorarbeiten.
Die Grazer Stadtarchäologie sortiert freilich nicht nur aus, sondern kümmert sich auch um all jene Funde, die wir aufbewahren können. Zudem präsentieren wir der Öffentlichkeit Teile unserer Arbeit.
Ein paar Eckdaten zu den bei uns befindlichen Objekten: Mit Stand 25. August 2025 lagern in unserem Depot 1.050 Euroboxen bzw. Styroporkisten mit Funden. Weitere (Groß-)Funde liegen auf 38 Paletten (davon 18 Paletten mit Architekturteilen). Die Funde stammen von 38 archäologischen Ausgrabungen (Maßnahmen), die seit 2017 auf Grazer Stadtgebiet stattgefunden haben. Die Gesamtzahl aller bei uns gelagerten archäologischen Funde schätzen wir auf 65.000 Einzelobjekte – von kleinen Kunststoffknöpfen bis hin zu einer Panzereinstiegsluke. Der überwiegende Großteil der Funde stammt aus zeitgeschichtlichen Kontexten, wenige ältere datieren ab dem 17. Jahrhundert.
Bewahrung von Funden


Nur in seltenen Fällen wurden Fundstücke bereits in gereinigtem Zustand an die Stadtarchäologie übergeben.[9] Aus diesem Grund wurden gemeinsam mit Restauratorin Eva Schantl Konzepte zur Reinigung und Lagerung der einzelnen Materialgruppen (Keramik, Glas, Metall, organische Funde, Stein etc.) entwickelt. Da die Behandlung von modernen Kunststoffen aus Restauratoren·innensicht erst im Anfangsstadium ist, werden auch neue Methoden erprobt.
Nach einer Übernahme erfolgt zuerst eine Durchsicht aller Objekte, die Klassifizierung in die einzelnen Materialgruppen und die Festlegung der idealen Lagerungsbedingungen. Da organische Funde (Leder, Textilien, Kunststoffe, tierische Überreste etc.) dabei am empfindlichsten reagieren, werden diese immer zuerst trocken gereinigt und dann, unter Zugabe von Feuchtigkeitsstabilisatoren, in Klimaboxen aus Styropor (die ansonsten für die Verschickung von Lebensmitteln verwendet werden) gelagert – in diesen herrscht ein annähernd konstantes Klima, was Temperatur und Luftfeuchtigkeit anbelangt.[10]
Die meisten anderen Funde werden erst dann gereinigt, wenn sie inventarisiert werden. Keramik (Irdenware und Porzellan) werden nass gereinigt, Glasobjekte nass oder trocken (je nachdem, ob sich darauf noch Reste von Papieretiketten befinden), Metall, Steine und Kunststoffe trocken. Mit Stand 25. August 2025 sind 1.399 Einzelobjekte und kleinere Konvolute aus dem Bereich des Lagers Liebenau inventarisiert. Dafür werden die Objekte nach ihrer Reinigung fotografiert, vermessen, beschrieben und datiert.
Nach ihrer Inventarisierung werden die Objekte, versehen mit Inventarnummern, nach restauratorischen Vorgaben einzeln verpackt. Während dabei Glas und Keramik in vorgeschnittene Fächer in Ethafoam-Platten gesteckt werden können, müssen Kunststoff- und Metallobjekte zum Teil auf eigenen Platten montiert und mit einem Feuchtigkeitsregulator und -anzeiger eingeschweißt werden. Gelagert werden die Funde schlussendlich in stapelbaren Euroboxen.
Das Kulturerbe Digital-Projekt „Liebenau 3D“
Derzeit werden zudem 350 ausgewählte Objekte im Rahmen des vom Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport geförderten Kulturerbe Digital-Projektes „Dem Vergessen entrissen – Digitalisierung persönlicher Objekte aus dem Bereich des ehem. Zwangsarbeitslagers Liebenau” mittels 3D-Scanner von Anna Zelenka aufgenommen. Es handelt sich dabei einerseits um persönliche Gegenstände aus dem direkten Lagerkontext und andererseits um Objekte wie bemalte Porzellanpfeifen, die auf ältere Befunde hinweisen, aber vermengt mit jüngeren Funden in den Gruben im Lagerareal entdeckt wurden. Nach Abschluss des Projektes im Frühjahr 2026 werden die 3D-Scans über die Homepage des Graz Museums ( https://www.grazmuseum.at/) abrufbar sein. Erste Ergebnisse konnten der Öffentlichkeit im Rahmen des diesjährigen Frühlingsfests und am Aktionstag zum Kriegsende am 8. Mai 2025 im Graz Museum präsentiert werden.
https://www.grazmuseum.at/) abrufbar sein. Erste Ergebnisse konnten der Öffentlichkeit im Rahmen des diesjährigen Frühlingsfests und am Aktionstag zum Kriegsende am 8. Mai 2025 im Graz Museum präsentiert werden.
Forschungen zum vergessenen Friedhof in der Puchstraße
Neben den Fundorten des 20. Jahrhunderts und den damit verbundenen Fragestellungen beschäftigt die Stadtarchäologie derzeit vor allem ein weiterer Fundort: Im August 2024 wurde bei Straßenbauarbeiten im Bereich der Puchstraße ein bislang unbekannter neuzeitlicher Friedhof entdeckt. Auf dem rund 300 m² großen Grabungsareal wurden Knochen von mindestens 56 Individuen (Frauen und Männern) gefunden. Die Skelette von 27 Individuen befanden sich bei ihrer Freilegung noch in ihrer ursprünglichen Bestattungslage. Ihre Einzelbestattung in gestreckter Rückenlage belegt, dass es sich um kein Massengrab handelte, sondern um reguläre Einzelbestattungen. Aufgrund der archäologischen Funde, der Ergebnisse der 14C-Analyse und des historischen Kontextes lässt sich eine Datierung des Friedhofes für den Zeitraum von 1724 bis 1826 annehmen. Warum der Friedhof in Vergessenheit geriet und woher die Toten kamen, ist nach aktuellem Forschungsstand noch nicht klar – weitere Forschungen in Archiven sind dazu notwendig.
Science to public


Eine der wichtigsten Aufgaben der Stadtarchäologie war und ist die Vorstellung unserer Arbeiten und die Sichtbarmachung des archäologischen Erbes der Stadt Graz. Dies geschieht einerseits über Veranstaltungen, die im Graz Museum selbst stattfinden (z. B. beim Frühlingsfest oder bei Sonderveranstaltungen wie dem Thementag zum 80 Jahre Jubiläum des Kriegsendes 1945), und andererseits durch Veranstaltungen vor Ort, wie der Eröffnung der Neutorgasse[11], Führungen durch das Depot der Stadtarchäologie[12], einen Spaziergang zu den Hügelgräbern im Leechwald[13] oder bei Gedenkveranstaltungen der Initiative Lager Liebenau[14]. Für den Tag des Denkmals am 28. September 2025[15] ist eine Führung durch das Areal des ehemaligen Zwangsarbeitslagers Liebenau mit Besuch des denkmalgeschützten Kellers geplant.
Einzelne Funde aus dem Lager Liebenau und von den Reininghausgründen werden monatlich auf Facebook als „Archäologische Fundstücke der Woche” präsentiert. Die bisherige Bandbreite reicht von einem Nachttopf aus Porzellan über ein bemaltes Sparschwein aus Irdenware bis hin zu einer in der Glasfabrik Gösting hergestellten Bierflasche.
Aber auch im Rahmen von Vorträgen werden Grazer archäologische Funde und Fundstätten präsentiert. Als Beispiel sei hier mein Vortrag „Warum gab es bei uns so wenige Römer·innen?”[16] im Rahmen der „Vor.Stadt. Geschichten 2.0” am 19. November 2024 genannt. Die sehr gut besuchten Veranstaltungen dieser Reihe finden seit 2023 als Kooperation der Stadtbibliothek Graz mit dem Graz Museum und dem Stadtarchiv Graz statt, gehen also im Herbst/Winter 2025/26 bereits in die dritte Runde[17].
Archäologische Funde aus Graz sind derzeit im Rahmen der Sonderausstellung „Graz 1699” der STEIERMARK SCHAU im Archäologiemuseum in Schloss Eggenberg zu sehen – noch bis zum 2. November 2025 und dann wieder ab Ende März bis Ende Oktober 2026. Neben Objekten und einer großartigen 3D-Visualisierung von Graz Ende des 17. Jahrhunderts gibt es u. a. ein Video, in welchem ich an verschiedenen neuzeitlichen Fundorten diese kurz vorstelle: im Keller des Palais Khuenburg (Graz Museum), in der Nähe des ehemaligen Neutors, an der Stelle des ehemaligen St.-Georgs-Friedhof und unterhalb der Leechkirche.
Zum Abschluss ein kurzer Ausblick auf den 2026 erscheinenden Band 54 des Historischen Jahrbuchs der Stadt Graz: Dieser steht unter dem Motto „(Stadt)Archäologie in Graz” und wird in über 15 Beiträgen bekannte und weniger bekannte archäologische Fundstätten quer durch die Jahrtausende vorstellen. Graz besitzt nämlich ein überaus reiches archäologisches Erbe, auch wenn man es nicht immer sieht.
Anmerkungen
[1] Dabei kann man sich darüber streiten, ob eine archäologische Grabung im heutigen Rom bzw. Athen ebenso unter Stadtarchäologie fallen könnte und nicht nur unter Klassische Archäologie.
[2] Eine ausführliche Darstellung der Entstehungsgeschichte der Stadtarchäologie erscheint im Frühjahr 2026 unter dem Titel „Wie es zur Gründung der Stadtarchäologie in Graz kam – Forschungsgeschichte und Perspektive einer noch jungen Einrichtung” im Tagungsband des 19. Archäologietags, abgehalten 3.–5. 4. 2024 in Innsbruck.
[3] Hier ist noch anzumerken, dass die Zuständigkeit zweigeteilt ist: Die Lagerung der Funde fällt unter die Zuständigkeit der Abteilung für Immobilien der Stadt Graz, die fachliche Betreuung obliegt der Stadtarchäologie am Graz Museum.
[4] Der Kriterienkatalog umfasst die Fragen: 1. Handelt es sich um ein historisch „belastetes” Artefakt? 2. Besitzt der Fund eine wissenschaftliche Bedeutung? 3. Besitzt der Fund eine historische Bedeutung? 4. Stellt der Fund ein potenzielles Ausstellungsexponat dar? 5. Handelt es sich um ein „Kuriosum” bzw. einen Sonderfund?
[5] Zur Definition von Massenfunden siehe Bundesdenkmalamt (Hg.), Archäologische Maßnahmen, Version 1, September 2024 (Wien 2024), 41-43 [ Online-Fassung].
Online-Fassung].
[6] Zu den NS-Opferorten in Österreich:  https://www.bda.gv.at/service/unterschutzstellung/denkmalverzeichnis/liste-der-ns-opferorte-in-oesterreich.html (22. 8. 2025).
https://www.bda.gv.at/service/unterschutzstellung/denkmalverzeichnis/liste-der-ns-opferorte-in-oesterreich.html (22. 8. 2025).
[7] Dies umfasst sowohl personellen als auch materiellen Aufwand.
[8]  https://de.wikipedia.org/wiki/Hiller-Kaserne (25. 8. 2025). Zu den Grabungen 2021 siehe Heinz Gruber, Oberösterreich. In: Fundberichte aus Österreich [in Folge: FÖ] 60 (2021/2024), 17f. und Wolfgang Klimesch/Martina Reitberger-Klimesch u. a., Archäologische Grabungen Hiller-Kaserne Ebelsberg Gst. 154/35. In: FÖ 60 (2021/2024), D8100-D8147 bzw. zu den Grabungen 2022 siehe Heinz Gruber, Oberösterreich. In: FÖ 61 (2022/2025), 18 und Wolfgang Klimesch/Martina Reitberger-Klimesch u. a., Bericht Archäologische Grabung Hiller-Kaserne Linz-Ebelsberg, KG Ufer, Gst. 154/7 und 154/35. In: FÖ 61 (2022/2025), D6953-D6979.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hiller-Kaserne (25. 8. 2025). Zu den Grabungen 2021 siehe Heinz Gruber, Oberösterreich. In: Fundberichte aus Österreich [in Folge: FÖ] 60 (2021/2024), 17f. und Wolfgang Klimesch/Martina Reitberger-Klimesch u. a., Archäologische Grabungen Hiller-Kaserne Ebelsberg Gst. 154/35. In: FÖ 60 (2021/2024), D8100-D8147 bzw. zu den Grabungen 2022 siehe Heinz Gruber, Oberösterreich. In: FÖ 61 (2022/2025), 18 und Wolfgang Klimesch/Martina Reitberger-Klimesch u. a., Bericht Archäologische Grabung Hiller-Kaserne Linz-Ebelsberg, KG Ufer, Gst. 154/7 und 154/35. In: FÖ 61 (2022/2025), D6953-D6979.
[9] Die Stadtarchäologie führt aufgrund der fehlenden personellen und technischen Ressourcen keine Ausgrabungen selbst durch, sondern übernimmt die Funde von Archäologiedienstleistern, die von den jeweiligen Abteilungen des Hauses Graz beauftragt worden sind.
[10] Für die Lagerung und Aufbewahrung von Museumsobjekten gibt es einen Klimakorridor von 16-25°C und 40-60% rel. Luftfeuchtigkeit, in dem Objekte aufbewahrt werden sollten, um keinen Schaden zu nehmen; siehe  https://www.cimam.org/news-archive/bizots-refreshed-green-protocol-2023/ (26. 8. 2025).
https://www.cimam.org/news-archive/bizots-refreshed-green-protocol-2023/ (26. 8. 2025).
[11]  https://www.grazmuseum.at/event/eroeffnungstage-im-neutorviertel/ (29. 8. 2025).
https://www.grazmuseum.at/event/eroeffnungstage-im-neutorviertel/ (29. 8. 2025).
[12]  https://www.grazmuseum.at/event/fuehrung-durch-das-depot-der-stadtarchaeologie-graz/ (29. 8. 2025).
https://www.grazmuseum.at/event/fuehrung-durch-das-depot-der-stadtarchaeologie-graz/ (29. 8. 2025).
[13]  https://www.grazmuseum.at/event/huegelgraeber-und-statuen-auf-archaeologischen-spuren-durch-geidorf/ (29. 8. 2025). Bericht dazu: https://www.krone.at/3297712 (29. 8. 2025).
https://www.grazmuseum.at/event/huegelgraeber-und-statuen-auf-archaeologischen-spuren-durch-geidorf/ (29. 8. 2025). Bericht dazu: https://www.krone.at/3297712 (29. 8. 2025).
[14]  https://gedenken-liebenau.at/gedenkinitiative-graz-liebenau.phtml (29. 8. 2025).
https://gedenken-liebenau.at/gedenkinitiative-graz-liebenau.phtml (29. 8. 2025).
[15]  https://www.grazmuseum.at/event/archaeologischer-spaziergang-durch-das-ehemalige-zwangsarbeitslager-liebenau/ (29. 8. 2025).
https://www.grazmuseum.at/event/archaeologischer-spaziergang-durch-das-ehemalige-zwangsarbeitslager-liebenau/ (29. 8. 2025).
[16]  https://www.grazmuseum.at/event/warum-gab-es-bei-uns-so-wenige-roemerinnen/ (29. 8. 2025).
https://www.grazmuseum.at/event/warum-gab-es-bei-uns-so-wenige-roemerinnen/ (29. 8. 2025).
[17]  https://stadtbibliothek.graz.at/Veranstaltungen/details/8803/mid/431/dateId/8811/vor-stadt-geschichten (29. 8. 2025).
https://stadtbibliothek.graz.at/Veranstaltungen/details/8803/mid/431/dateId/8811/vor-stadt-geschichten (29. 8. 2025).
Mag.a Dr.in Susanne Lamm studierte Klassische Archäologie (Schwerpunkt Provinzialrömische Archäologie) und Deutsche Philologie an der Universität Graz. Ihre Dissertation 2011 befasste sich mit der römischen Villa von Grünau (Weststeiermark). Seit 2011 ist sie als selbstständige Archäologin in den Bereichen Forschung (Fundaufarbeitungen) und Vermittlung (Science to public; Podcast „Artefakte erzählen”) tätig. 2008–2023 war sie Lehrbeauftragte am Institut für Antike (ehem. Archäologie) der Universität Graz mit Kursen zum wissenschaftlichen Arbeiten, zur Austria Romana, der Völkerwanderungszeit, römischen Villen und den Nordwestprovinzen. 2021–2022 war sie Mitarbeiterin der Archäologiefirma Novetus. Seit November 2022 leitet sie die Stadtarchäologie am Graz Museum.