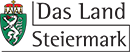Die Steiermark als dynastische „Sommerfrische“*
Peter Wiesflecker

In seiner unter dem Titel „Letzter Glanz der Märchenstadt” erschienenen, gleichermaßen pointierten wie facettenreichen Schilderung Wiens um 1900 kommt Otto Friedländer auch auf die Sommerfrische zu sprechen: Die liebste Sommerfrische [...] ist das Salzkammergut. [...] Da der kaiserliche Hof und noch ein halbes Dutzend Könige den Sommer im Salzkammergut verbringen, sind auch die Verbindungen erträglich. [...] Das wäre alles schön und gut, wenn man in dieser prächtigen Gegend auch angenehm und nicht zu teuer leben könnte. Aber leider fehlt im Salzkammergut auch fast alles, was das Leben behaglich machen kann.
Im Unterschied dazu sei Tirol mondän und zudem finde sich dort ein ganz anderes Publikum: Keine Könige, die immer zwischen zeremoniöser Steifheit und ihrer Neigung zum niederen Volk (dort wo es am derbsten ist) schwanken, keine protzigen Millionäre, keine lauten Boheme, keine murrenden und trotz allen Schimpfens ausgebeuteten Bürger, sondern patrizisch vornehmes Publikum aus dem deutschen Westen und die unvermeidlichen Engländer. [...] Im Salzkammergut bleibt noch immer eine Menge zurück: der Kaiser und die Fürstlichkeiten, die fremden Diplomaten und all die hohen Herrschaften, die den Höfen nahe sein müssen oder wollen.
Auch der Blick eines anderen Zeitzeugen der ausklingenden Donaumonarchie auf die inneralpinen Kernländer war ähnlich. In seinen Lebenserinnerungen hielt Alois Prinz Auersperg (1897–1984) fest, die großen Familien hatten ihren zusätzlichen Besitz in den Alpenländern der Jagd wegen oder [wegen] der dort sehr lieben Bevölkerung, Erträge versprach man sich daraus keine.
Mehrere Jahrzehnte zuvor hatte der regierende Fürst Johann Josef I. von und zu Liechtenstein (1760–1836) steirische Güter anders beurteilt. Die von ihm erworbenen weststeirischen Herrschaften Deutschlandsberg und Hollenegg sowie die südoststeirischen Herrschaft Riegersburg fasste er in einem Fideikommiss für seinen zweitgeborenen Sohn Franz (1802–1887) zusammen, um auch diesen – wie der Fürst in einer Denkschrift festhielt – das den Abkömmlinge[n] [...] seines Hauses [...] durch Jahrhunderte ererbte Ansehen zu erhalten. Der Besitzkomplex repräsentierte im Jahr 1820 einen Wert von rund einer Million Gulden (2025: 25,3 Millionen €) und garantierten dem Prinzen ein standesgemäßes Einkommen. Dessen Enkel Johannes Prinz von und zu Liechtenstein (1873–1959) schrieb dazu in seinen Lebenserinnerungen: Als mein Urgrossvater diese Besitztümer kaufte, galten diesselben der zahlreichen auf den Ländereien lebenden Untertanen wegen, welche der Herrschaft zur Zehentzahlung verpflichtet waren, als sehr wertvoll. Durch die Grundablöse [...] hörte zwar die Zehentabgabe auf, dafür wurde diese kapitalisiert und die Zinsen dieses Kapitals bildeten hauptsächlich das Haupteinkommen der sonst nicht sehr einträglichen steirischen Herrschaften. [...] Trotzdem hatte mein Vater ein recht ansehnliches Einkommen und konnte ein sehr großes Haus führen und sowohl am Lande als auch in der Stadt zahlreiche Gäste bei sich sehen.
Der steirische Besitz wurde von der Familie Liechtenstein bis zum Ende der Monarchie vorrangig für Jagdaufenthalte genützt. Vor allem die Koralpe bot sich dafür an. Gemeinsam mit dem dänischen Kammerherrn August Schütte, der in den 1850er-Jahren die einstige Kameralherrschaft St. Andrä im Lavanttal erworben hatte, der schlesischen Adelsfamilie Henckel-Donnersmarck, die sich ebenfalls im Lavanttal angekauft hatte, und dem Stift St. Paul wurden von Franz Liechtenstein und seinem Sohn und Nachfolger Alfred (1842–1907) auf der Koralm riesige Jagdgebiete erschlossen und zeitweise sogar ein gemeinsamer Tiergarten eingerichtet.
Jagd und „Sommerfrische“
Die Steiermark als dynastische „Sommerfrische” war demnach vor allem aufgrund ihrer ausgedehnten Jagdgebiete attraktiv. Zuvor hatten Dynasten im Herzogtum nur im Ausnahmefall (und nicht immer ganz freiwillig) ihren Aufenthalt genommen wie Louis Bonaparte (1778–1846), der Bruder Napoleons und ehemalige König von Holland, oder die Herzogin von Berry (1798–1870), die Mutter des französischen Thronprätendenten, deren Itinerar den Wechsel zwischen Venedig, zeitweise Graz und der südsteirischen Herrschaft Brunnsee umfasste.
Auch der von Erzherzog Johann (1782–1859) als landwirtschaftliches Mustergut in hochalpiner Lage eingerichtete Brandhof wurde bald zum Zentrum eines ausgedehnten Jagdgebiets. Durch Zupachtungen aus Staatsbesitz umfasste dieses in seiner besten Zeit rund 20.000 Hektar. Der jährliche Sommeraufenthalt am Brandhof bestimmte auch den Jahreslauf der Nachkommen des Erzherzogs. Ladislaja Meran-Lamberg (1870–1952), die Frau des damaligen Familienchefs Johann Meran (1867–1947), versammelte alljährlich ihre in Summe rund drei Dutzend Enkel für Sommeraufenthalte am Brandhof. Einladungen zur Jagd in den Revieren des Brandhofes waren begehrt und wurden – selbst in der Familie – nur handverlesen ausgesprochen. In der späteren Zwischenkriegszeit wurden erstmals auch paying guests zugelassen, wie sich Meran-Enkel Nikolaus Harnoncourt (1929–2016) erinnerte: Es gab auch besondere Jagd- und Sommergäste unter den Erwachsenen. Einige Sommer kam ein ‚Kemal Pascha‘ aus Ägypten. Er hatte einen weißen Schnurrbart und ritt immer auf die Gamsjagd. Einmal kam ein ‚Maharadjah’ aus Indien, der wurde in einem Tragsessel getragen (er war nicht invalid, nur sehr reich und ‚vornehm’) – der hatte ein 12-schüssiges Schnellfeuergewehr und schoß ganz wild und unwaidmännisch herum, bis er endlich traf.
Im späteren 19. Jahrhundert finden sich in der Steiermark eine Reihe von hochadeligen Herrschaftsbesitzern. Auch ihr Interesse war – wie im Übrigen auch bei ihren Standesgenossen, den Familien Württemberg und Hannover-Cumberland, die im oberösterreichischen Teil des Salzkammergutes ausgedehnten Besitz erworben hatten – vorrangig durch die Jagd bestimmt.
Unter den dynastischen „Sommergästen” der Steiermark in dieser Zeit finden wir neben den Familien Sachsen-Coburg und Liechtenstein oder der kaiserlichen Familie auch die Bourbonen von Parma, die am Wechsel ein ererbtes Jagdrevier sukzessive arrondierten. 1897 hatte Prinzessin Therese von Bayern (1850–1938), eine geborene Prinzessin Liechtenstein und Schwiegertochter des Prinzregenten Luitpold, die Herrschaft Wasserberg in der Gaal erworben. Seit 1895 war im Schloss ein Gastbetrieb eingerichtet, der ab 1897 sukzessive zum Kurhotel ausgebaut wurde, wobei jedoch das Interesse der bayerischen Hoheiten vorrangig dem rund 12.000 Hektar großen Revier galt. 1906 verkaufte die Prinzessin diesen Besitz wieder. Am Ende der Reihe dieser Dynasten, die in der Steiermark einen Sommersitz erwarben, stand das letzte österreichische Kaiserpaar. 1913 erwarben der damalige Erzherzog Karl Franz Joseph (1887–1922) und seine Gemahlin Zita (1892–1989) Schloss Feistritz bei St. Peter am Kammersberg. In der Folge wurde das Gut als ländlicher Sommersitz für das junge Paar adaptiert. Am 4. Juli 1913 besuchten Karl und Zita erstmals offiziell ihren steirischen Land- und künftigen Sommersitz.
Der Charme des „einfachen“ Lebens


Die im Sommer oder zur Jagdsaison bezogenen „dynastischen” Destinationen in der Steiermark waren im Regelfall Schlösser oder zumindest schlossartige Ansitze. Hollenegg, Mürzsteg, das Coburgsche Jagdhaus in Schladming, der Brandhof oder auch Schloss Trautenfels der Familie Lamberg mögen stellvertretend genannt werden. Die Bauten, wie sie der Herzog von Württemberg oder das ehemalige Königshaus von Hannover in Oberösterreich hatten errichten lassen, übertrafen jedoch selbst gut ausgestattete steirische Destinationen bei weitem. Doch jede dieser Niederlassungen, da wie dort, erforderten einen entsprechenden Personaleinsatz. In einem fürstlichen/aristokratischen Haushalt waren bei längeren Landaufenthalten im Regelfall mehrere Dutzend Personen beschäftigt. Allein schon die Übersiedelung dieser Entourage war ein logistisches Unternehmen; dies galt für den Sommeraufenthalt von Familien wie Sachsen-Coburg oder Liechtenstein ebenso wie für nichtregierende Familien wie die Grafen Meran, wenn diese vom Grazer Stadtpalais nach Brandhof übersiedelten.
Herzog Robert von Parma (1848–1907) reiste alljährlich von Schloss Schwarzau in Niederösterreich mit einem Sonderzug an seinen italienischen Sommersitz, die Villa Pianore in Lucca. Kam er hingegen in sein steirisches Jagdrevier Gut Glashütte am Wechsel, so erwartete ihn dort nun keinerlei Luxus. Das vorhandene Jagdhaus bezeichnete der Herzog als Rattenloch, und so nahm er für die wenigen Tage, in denen er sich am Wechsel aufhielt, bei seinem Gutsverwalter Quartier. Die zunehmende Motorisierung machte es dann möglich, dieses ohnehin nur sporadisch genützte Jagdgebiet vom Parma-Schloss Schwarzau aus mit dem Auto zu erreichen. Ich bin [...] mit [...] Prinz Felix [von Parma, Anm.] hier und jage auf Hirsch und Gams. Leider haben wir entsetzliches Wetter, Schnee, eine schauderhafte Kälte und Sturm. In unserer Hütte haben wir nur einen offenen Herd und da der Wind den Rauch nicht hinaus lässt, sitzen wir hier wie in einer Selchküche. Ansonsten ist es eine Mordshetz, ich koche für uns beide und wir leben hier wie die Indianer, schrieb Thomas Graf Erdődy (1886–1931) Anfang Oktober 1917 an seine Mutter.
„Wie die Indianer” hausten jedoch Jagdherrn und Jagdgäste nur im Ausnahmefall, wenngleich der bereits zitierte Otto Friedländer süffisant anmerkte, in den inneralpinen Sommerfrischen könne man auch in die Wildnis gehen. Sehr billig ist es da auch nicht, dafür ist man aber von Konzert, Kursalon, Kaffeehaus stundenweit entfernt. In den ausgedehnten Revieren der Familie Meran verbrachte man hoch oben auf den Almen [...] oftmals einige Tagen auf den Hütten, wie Charlotte Keil-Meran (1929–2023) berichtete: [Daher] mussten alle unsere Jäger in der Lage sein, einfache Gerichte wie Brennsterz, Türkensterz oder Rehleber zustande zu bringen. Mit gutem Grund, ist man versucht zu sagen, denn, so Charlotte Keil, den Eltern wäre es [...] fast gelungen, [...] eine Meran'sche Jagdhütte [...] in Flammen aufgehen zu lassen, als sie mit mehr Mut als Geschick eine Rehleber braten wollten.
Eine wohltemperierte Mischung aus – nennen wir es – ländlicher Idylle und einem gewissen Grundkomfort boten Jagdhäuser in kleineren Dimensionen. Ein solches besaß die Nichte Kaiser Franz Josephs, Erzherzogin Maria Annunziata (1876–1961), in Hall bei Admont. Ihre Mutter Erzherzogin Maria Theresia (1855–1944) hatte sich eines in St. Jakob im Walde, unweit des Reviers ihres Schwagers Robert von Parma errichten lassen. Dort fand im Übrigen die inoffizielle Verlobung des letzten österreichische Kaiserpaares Karl und Zita statt.
In jedem Fall war die Anwesenheit „hoher” und „höchster” Herrschaften ein Wirtschaftsfaktor. Dies galt für das Jagdpersonal, das im Regelfall aus der Umgebung stammte, ebenso wie für Personen, die Hilfsdienste im Haushalt erledigten. Zudem konnte sich die Bevölkerung einer gewissen Protektion sicher sein.
Vom „Voluptuar“ zum Wirtschaftsbetrieb
Das Ende der Monarchie und die Zeiten von Hochinflation und Wirtschaftskrisen brachten selbst für jene Familien, die bis dahin zur Spitze der habsburgischen Hofgesellschaft gehört hatten, ökonomische Einschränkungen, die man ein Jahrzehnt davor noch nicht für möglich gehalten hätte. Davon war auch die Familie Sachsen-Coburg betroffen. Die Schlussrechnung für den Nachlass des 1922 verstorbenen Prinzen August Leopold (1867–1922) ergab im Jahr 1927 ein Nachlassvermögen von rund 410.000 öS (2025: 1,9 Millionen €), wobei den Hauptanteil der Aktiva der mehrere Tausend Hektar große Forstbesitz ausmachte. Somit war die Vermögensbilanz eher durchwachsen, als Leopold Augusts Witwe Caroline (1869–1945) den Besitz ihres Mannes übernahm. Schladming wurde ihr Hauptwohnsitz, wo sie mit ihren Töchtern Maria (1899–1941) und Leopoldine (1905–1978) lebte.
Gutsbesitz wie jener der Familie Sachsen-Coburg in der Steiermark hatte bis zum Ende der Monarchie als „Voluptuar" (Liebhaberei) gegolten. Den Erhalt und die Führung eines standesgemäßen Haushaltes finanzierte man überwiegend aus externen Mitteln (Apanagen, Wertpapiere). Der wirtschaftliche Ertrag, der aus dem Gut als solchem lukriert wurde, war (eher) nebensächlich. Nunmehr musste jedoch vor allem dieser Ertrag den Lebensunterhalt seines Inhabers sichern. In den späteren 1930er-Jahren brachen die Gewinne aus der sog. Waldrente ein. Als Apanage zur Deckung der Kosten im Schlosshaushalt in Schladming steuerte daher Carolines Sohn Philipp (1901–1985), der der Chef dieses Zweiges und zugleich Majoratsherr der Coburg'schen Besitzungen war, monatlich 2.500 öS (2025: 18.000 €) bei, wobei der Betrag nicht immer zur Deckung der [...] Kosten ausgereicht[e]. 1938 machte Philipp von Coburg seiner Mutter die Mitteilung, dass er die Apanage einstellen müsse, und unterbreitete ihr den Vorschlag, auf sein Schloss in Niederösterreich zu übersiedeln. Dies bedingte die Auflösung des Haushaltes in Schladming, dessen Personal sich bis dahin bereits erheblich verringert hatte. Die Köchin, ein Stubenmädchen und ein Kammerdiener, die noch im Haus tätig gewesen waren, mussten entlassen werden. Den Gutsbesitz in Schladming übergab Caroline ihrem Sohn Ernst (1907–1978), das Jagdhaus wurde verkauft.
Das von Prinz Alfred Liechtenstein innegehabte „steirische” Fideikommiss repräsentierte bei seinem Tod im Jahr 1907 einen Wert von rund 4,7 Millionen Kronen (2025: 37,7 Millionen €). Rund 70 bis 75 Prozent des Fideikommissvermögens bestand aus Wertpapieren, mit deren Ertrag sich – wie sein Sohn Johannes Liechtenstein schrieb – ein großes Haus führen ließ. Angesichts solcher Einkünfte war auch der Erhalt eines Sommersitzes wie Hollenegg kein Problem, wenngleich bereits eine Änderung in der Wahrnehmung und Nutzung des Besitzes eingetreten war: Ein erster Waldwirtschaftsplan wurde erstellt, unergiebige Bauten hatte man bereits verkauft (u. a. die Schlösser Kornberg und Schwanberg) oder vermietet (z. B. Feilhofen). Zwar verfügte das Haus Liechtenstein auch in der Zwischenkriegszeit noch über entsprechende Mittel, dennoch trat eine weitere Änderung in der Wahrnehmung des steirischen Besitzes ein: Alfreds Nachfolger Franz Liechtenstein (1868–1929) führte das Fideikommiss nach wirtschaftlichen Kriterien. Mit einem Kredit des Fürstenhauses finanzierte er die Erschließung des Forstbesitzes, wenngleich nicht alle Pläne – wie Gerhard Fischer in einer Studie gezeigt hat – von Erfolg gekrönt waren. Anlässlich des Todes von Franz hielt man aber fest: Als Meliorationen kommen die zur Erschließung der Koralpenwälder erbauten Wald- und Seilbahn- sowie Sägewerksanlagen in Betracht, wodurch Holzmassen bei der Bewertung berücksichtigt werden konnten, die zuvor als nur durch Trift hätten gewonnen werden können oder als unbringbar gegolten hatten und demnach (wesentlich) niedriger zu bewerten gewesen wären. In Summe hatte Franz Liechtenstein bis zu seinem Tod im Jahr 1929 rund 761.000 Schilling (2025: 3,4 Millionen €) in diese Industrieanlagen investiert.
Im Fall der Familie Liechtenstein war die Transformation geglückt. Anderen Familien, die ihren zum Teil ausgedehnten Waldbesitz vorerst nur für Jagdaufenthalte genützt hatten, glückte dieser Übergang nicht, wie den Grafen Bardeau, deren rund 12.000 Hektar großen Besitz in Gstatt verkauft werden musste. Eine weitere große Besitzveränderung betraf den steirischen Besitz der Industriellenfamilie Gutmann in Kalwang. Diesen Besitz erwarb zu Beginn der 1930er-Jahre der regierende Fürst Franz I. von Liechtenstein (1853–1938).
Dynastischer Nachklang
Selbst Angehörige souveräner oder vormals regierender Häuser konnten nach 1945 die „Welt von gestern” kaum noch in der bisherigen Form fortschreiben. Die Bourbonen von Parma hielten zwar ihren Besitz am Wechsel, führten jedoch in den 1980er-Jahren eine Realteilung durch und verkauften ihn in Folge zum Teil ab. Schloss Schwarzau (NÖ), von wo aus dieses Jagdgebiet gut zu erreichen gewesen war, hatte man bereits 1951 verkauft.
Ein europäischer Dynast fand sich jedoch durch mehrere Jahrzehnte in der Steiermark ein: Herzog Albrecht von Bayern (1905–1996), seit 1955 der Chef des ehemaligen bayerischen Königshauses. Seit seiner Jugend galten seine Interessen der Forstwirtschaft, Zoologie und Botanik, insbesondere aber der Jagd. Neben den bayerischen Forsten war das steirische Revier Weichselboden, das einstmals zum Jagdgebiet Erzherzog Johanns gehört hatte, sein bevorzugter Studien- und Aufenthaltsort. Ein Ergebnis seiner langjährigen Forschungen war die gemeinsam mit seiner zweiten Frau herausgegebene Publikation „Über Rehe in einem steirischen Gebirgsrevier”. Die Münchner Universität würdigte Albrechts Forschungen mit einem Ehrendoktorat der Veterinärmedizin.
Schlussendlich sei noch auf eine europäische Dynastin verwiesen, für die am Ende ihres langen Lebens die Steiermark tatsächlich zum Sommeraufenthalt wurde: Die letzte österreichische Kaiserin Zita verbrachte zwischen 1982 und 1988 den Sommer auf Schloss Waldstein, dem Besitz ihres Schwiegersohnes Heinrich Liechtenstein (1916–1991). Im Juli 1983 kehrte sie für einen Tag auch nach St. Jakob im Walde, dem Ort ihrer inoffiziellen Verlobung, zurück und wurde dort mit allen Ehren empfangen. „Ein Monarch ist nie privat!” soll Friedrich der Große gesagt haben. Dies galt wohl auch für die letzte österreichische Kaiserin, selbst in diesen späten Jahren ihrer steirischen „Sommerfrische”.
* Der Beitrag ist eine überarbeitete Fassung des am 18. September 2025 in Schladming anlässlich der 54. Arbeitstagung der Korrespondentinnen und Korrespondenten der Historischen Landeskommission für Steiermark gehaltenen Vortrags.
Quellen und Literatur (in Auswahl):
Steiermärkisches Landesarchiv: Landtafel und die dazugehörige Urkundensammlung; Grundbuch BG Schladming; Fideikommissakten; Verlassenschaftsabhandlungen nach Alfred Prinz von und zu Liechtenstein (1907), Franz Prinz von und zu Liechtenstein (1929), Leopold August Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha (1922-1927), Caroline Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha (1945) sowie Rückstellungsakt betreffend die Verlassenschaft nach Caroline von Sachsen-Coburg und Gotha (1949).
Familienarchiv Liechtenstein (Hollenegg): Lebenserinnerungen von Johannes Prinz von und zu Liechtenstein.
Schematismus des landtäflichen Besitzes im Herzogtum Steiermark (Graz 1901).
- Monika Faes, Schladmings vergessene Prinzessin. Maria Karoline Prinzessin von Sachsen-Coburg und Gotha (1899–1941). In: Heimatkundliche Blätter von Schladming 81 (11/2021), 1–6.
- Gerhard Fischer, 200 Jahre Haus Liechtenstein in der Weststeiermark (Deutschlandsberg 2020).
- Otto Friedländer. Letzter Glanz der Märchenstadt. Bilder aus dem Wiener Leben um die Jahrhundertwende 1890–1914 (Wien [1948]).
- Günter Fuhrmann, Haus der Könige. Das Wiener Palais Coburg. Throne, Triumphe, Tragödien (Wien 2018).
- Nikolaus Harnoncourt, Meine Familie. Herausgegeben von Alice Harnoncourt (Salzburg–Wien 2018).
- Charlotte Keil-Meran, Jagd in der Tradition Erzherzog Johanns. In: Josef Riegler (Hg.), Erzherzog Johann. Mensch und Mythos (= Veröffentlichungen des Steiermärkischen Landesarchives 37, Graz 2009), 173–178.
- Karl Kraus, Geheimkurier, Freischärler, Feuerwehrmann. Das Leben des Grafen Thomas Erdődy 1886 bis 1931 (= Burgenländische Forschungen 114, Mattersburg 2022).
- Peter Wiesflecker, Sicherung standesgemäßer Existenz. Streiflichter auf den Gutsbesitz der Familie Meran. In: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 113 (2022), 175–244.
- Peter Wiesflecker, Zwischen Rosegg und Hollenegg. Ein Blick auf den innerösterreichischen Besitz des Hauses Liechtenstein im 19. und frühen 20. Jahrhundert. In: Bulletin des Geschichtsvereins für Kärnten (2/2025), 94–100.
ArR Priv.-Doz. Mag. DDr. Peter Wiesflecker MAS, LL.M., MA, Studien der Geschichte, Archivwissenschaft, Geschichtsforschung und des Kirchenrechts in Wien und der Religionswissenschaften in Graz, seit 1998 wissenschaftlicher Beamter am Steiermärkischen Landesarchiv; Privatdozent für Österreichische Geschichte an der Universität Graz, Lehrbeauftragter für Archivwissenschaft an den Universitäten Wien und Graz sowie für Österreichische Geschichte/Archivwissenschaft an der Universität Klagenfurt. Mitglied der Historischen Landeskommission für Steiermark;
Forschungsschwerpunkte: Österreichische Geschichte, Landesgeschichte, Adelsgeschichte, Kirchenrecht, Volkskunde und Archivwissenschaften.