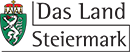Die Glocken von Jörg Wening in den Schlössern Wildbach (gegossen 1559) und Thannhausen (gegossen 1566) – Vergessenes aus steirischen Glockenstuben (Teil 3)
Meinhard Brunner
Einleitung
Zu den vielleicht weniger geläufigen Sehenswürdigkeiten der Stadtgemeinde Deutschlandsberg zählt das Schloss Wildbach im gleichnamigen Ortsteil. Wie einer Bauinschrift an der Ostseite zu entnehmen ist, wurde die Neuerrichtung dieses Gebäudes 1540 unter Sigmund von Wildenstein (gest. 1570) abgeschlossen. Sein heutiges Aussehen erhielt es durch Umbauten im Laufe des 18. Jahrhunderts.[1]
Rund 50 km Luftlinie nordöstlich von Wildbach liegt das Schloss Thannhausen, von dem die dortige Ortsgemeinde ihren Namen ableitet. Dieser Anlage mangelt es nicht an Bekanntheit, zumal es sich um eines der vorrangigen steirischen Renaissancebauwerke handelt.[2] Hier verweist eine Bauinschrift (dat. 1585) neben dem Einfahrtsportal auf Konrad von Thannhausen (gest. 1601) und seine Gemahlin Dorothea (gest. 1605).[3]
Zwei klangvolle Bindeglieder der beiden Schlösser bilden nun den Ausgangspunkt des vorliegenden Beitrages. In Wildbach und Thannhausen befindet sich jeweils eine Glocke aus der Grazer Werkstatt von Jörg Wening. Einmal abgesehen von ihrer Herkunft ist den beiden Exemplaren auch gemein, dass sie bislang in lokal- oder kunstgeschichtlichen Schriften sowie glockenkundlichen Publikationen weitestgehend ignoriert wurden.[4] Ein guter Grund also, um mit ihnen die Blog-Reihe „Vergessenes aus steirischen Glockenstuben“ fortzusetzen.
Ehe näher auf den Gießer eingegangen wird, soll noch kurz über das Setting seiner Werke in den genannten Schlössern gesprochen werden. Im Dachstuhl von Wildbach hängt die einzig verbliebene, relativ kleine Glocke fast etwas verloren. Nichtsdestoweniger hat sie nach wie vor eine Aufgabe zu erfüllen, denn sie dient als Totenglocke, wenn in der Ortschaft ein Trauerfall zu beklagen ist.[5]
Im Dachreiter von Thannhausen geht es ‚geselliger‘ zu. Er birgt neben der Wening-Glocke auch noch zwei jüngere Stücke, die von anderen Meistern geschaffen wurden. Sie tragen folgende Inschriften:
Jörg Wening



Der Büchsenmeister Georg (= Jörg) Wening kam um 1550 aus Regensburg nach Graz. Hier ist er im Jahr 1552 mit einem Monatsgehalt von 12 fl. als Auftragnehmer der steirischen Landschaft nachweisbar.[9] Wie für seine Zunft üblich, stellte er nicht nur Waffen her, sondern verdiente sich sein Geld auch als Glockengießer.
Nach heutigem Kenntnisstand sind insgesamt vier Glocken erhalten geblieben, die qua Meisterinschrift sicher von Jörg Wening stammen:
- Schloss Wildbach (1559):[10]
- Marktkirche Vorau (Betglocke, 1563):[13]
- Durchmesser: 84 cm; Gewicht: ca. 350 kg[14]
- am Hals dreizeilige Inschrift: IN + GOTES · NAMEN PIN ICH GEFLOSEN + IORG + WENING + ZV[15] + GRACZ[16] + HAT MICH + GOSEN + 156III + / DEVS MISERIATVR NOSTRI + ET BENEDICAT NOBIS · ILVMINAT VVLTVM SVVM [S]VPER NOS + ET MSERATVR[17] + / NOSTRI + OS[W]ALDVS + REIBSTAIN + PREP[O]SITVS + 156III
- Glockenschmuck: an der Flanke auf zwei Seiten Reliefbild mit Kreuzgruppe (Christus am Kreuz, Maria, Johannes)
- Diese Glocke befand sich bis 1872 in der Stiftskirche Vorau.[18]
- Die Stifterinschrift weist Propst Oswald Reibenstein als Auftraggeber des Gießers aus. Reibenstein leitete das Stift Vorau von 1556 bis zu seinem Tod 1585 und damit zu einer Zeit, als der Protestantismus in der Steiermark auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. Im Stift hielten sich nur wenige Chorherren auf, deren Lebensführung überdies bei der Visitation 1575 bemängelt wurde. Propst Reibenstein hatte selbst zwei Söhne. Außerdem wurde ihm die nötige Bildung für die Ausübung seines Amtes abgesprochen.[19]
- Pfarrkirche Stiwoll (1565):[20]
- Durchmesser: 72 cm, Gewicht: ca. 200 kg[21]
- am Hals zweizeilige Inschrift: EIN[22] · GOTTES · NAMEN · BEIN[23] · ICH · FLOSSEN · GERG[24] · WENNICH · HAT · / MICH · GOSSEN · ZV · GRATZ · KLEMENT · DIETZ · IACKVP · LENS 1565
- Glockenschmuck: an der Flanke jeweils auf zwei Seiten Reliefbild mit Kreuzgruppe (Christus am Kreuz, Maria, Johannes) und kleines Reliefbild der Krönung Mariens
- Bei den genannten Glockenstiftern Klement Dietz und Jakob Lens dürfte es sich um Kirchenpröpste handeln.
- Schloss Thannhausen (1566):[25]
- Durchmesser: 48 cm
- am Hals zweizeilige Inschrift: WENING + ZV[26] + GRACZ[27] + HAT + MICH + GOSSEN + 1566 + / IORG + IN + GOTES + NOMEN + PIEN[28] + ICH + GEFLOSSEN +
- an der Flanke (ungelenk eingravierte) Stifterinschrift: GORG[29] · KLEIN · DIENST · ZV · BAIXEN[30] · EGKH · LIS MICH GISEN[31]
- Diese Glocke dürfte aus der Burg Waxenegg stammen.[32] Ihre Übertragung nach Thannhausen erfolgte wohl bald nach dem Erwerb der Herrschaft Waxenegg durch Johann Graf von Khevenhüller-Metsch im Jahr 1761. Khevenhüller-Metsch vereinigte seine Neuerwerbung mit der Herrschaft Thannhausen und überließ die Burg Waxenegg dem Verfall.[33]
- Georg Kleindienst (d. J.) war der Sohn (und Besitznachfolger) von Georg Kleindienst d. Ä. (gest. 1562), welcher zuerst als Pfleger und ab 1556 als Eigentümer der Herrschaft bzw. Burg Waxenegg firmierte.[34] Georg d. J. heiratete 1578 auf der Burg (Alt-)Schielleiten Judith, geb. von Ratmannsdorf (gest. 1596).[35] Er verstarb am 1. November 1595.[36]
Der erfahrene österreichische Campanologe Jörg Wernisch ordnet zwei weitere Glocken, die keine Meisterinschrift aufweisen, dem Gießer Jörg Wening zu: Pfarrkirche Pöllau (1549)[37] und Pfarrkirche Bad Gams (1551)[38].
Abgekommen sind Jörg Wenings Glocken für Gleinstätten (1557)[39] und für Rachau[40]. Schließlich dürfte auch eine mutmaßlich 1560 gegossene Glocke der Pfarrkirche Hitzendorf, die im Ersten Weltkrieg abgeliefert werden musste, von diesem Gießer stammen.[41]
Marx Wening
Bei Gelegenheit dieses Blog-Beitrages nicht unerwähnt bleiben soll Jörg Wenings Sohn Marx, der bei seinem Vater das Gießerhandwerk erlernt hatte. Anfänglich noch in Regensburg tätig,[42]; ließ er sich 1575 in Graz nieder. Er arbeitete zunächst für den innerösterreichischen Landesfürsten, wechselte aber 1591 in den Dienst der steirischen Stände. Neben zahlreichen Glocken und Geschützen stellte Marx Wening auch Modelle für Münzen her.[43] Weiters zeichnete er mit Thomas Auer für den Guss des Grazer Landhausbrunnens verantwortlich.[44] Im Jahr 1600 wurde Marx Wening wegen seines protestantischen Glaubens ausgewiesen. Daraufhin übersiedelte er nach Wien, wo er 1601 das Bürgerrecht erhielt.[45] Durch seinen Sohn Georg wurde die Familientradition der Glockengießerei noch eine Generation weitergeführt.[46]
Von Marx Wenings Glocken sind mind. zehn Exemplare erhalten geblieben: in der Steiermark in Graz (Joanneum, 1585, ursprünglich aus Zeutschach; Landhaus, 1586, 2 Stück; Graz-St. Veit, Pfk., 1586)[47], in Burgau (Pfk., 1586)[48], in Tobelbad (Pfarrhof, 1589, 2 Stück)[49] und in Stainz (Pfk., 1590)[50] sowie in Kärnten (Wolfsberg, Stadtpfk., 1590)[51] und in Niederösterreich (Sallingberg, Pfk., 1603, bereits in Wien gegossen)[52].
Marx Wenings 1577 gegossene Glocke für die Pfarrkirche Miesenbach fiel im April 1945 dem Kirchturmbrand zum Opfer.[53] Das 1583 für die Pfarrkirche Stubenberg hergestellte Exemplar wurde 1928 entfernt.[54] Seine 1595 geschaffene große Glocke der Stiftskirche St. Lambrecht war 1624 gesprungen und musste ersetzt werden.[55] Ebenfalls verloren sind Wenings Glocken für die Pfarrkirche Semriach (1588)[56], für die ehem. Georgskapelle vor den Toren des Stiftes Rein (1592)[57] und für das Schloss Ehrnau bei Mautern (1598)[58].
Glockenablieferungen in Wildbach und Thannhausen
Rein zahlenmäßig waren von den Glockenablieferungen zur Unterstützung der Rüstungsproduktion während der beiden Weltkriege überwiegend Kirchenglocken betroffen.[59] Aber natürlich gerieten ebenso die Profanglocken ins Visier der Behörden.
Das Schloss Wildbach verfügte ursprünglich über zwei Glocken. Neben der obgenannten Wening-Glocke (1559) existierte noch ein größeres Exemplar aus dem Jahr 1583.[60] Sie waren im Ersten Weltkrieg wegen ihres historischen bzw. künstlerischen Wertes noch unangetastet geblieben. Im Dezember 1941 beantragte Gaukonservator Dr. Walter Semetkowski denn auch ihre Einreihung in die Kategorie „D“, wodurch sie abermals der Ablieferung entgangen wären.[61] Diese Initiative blieb freilich vorerst erfolglos, denn im Frühjahr 1943 wurde dem Schloss(mit)besitzer Dr. Eugen Mihurko durch die Kreishandwerkerschaft Deutschlandsberg die Abnahme beider Glocken avisiert. Der Konservator der Kunstdenkmäler in Berlin, Robert Hiecke, erlaubte dann jedoch den Verbleib der kleineren Glocke.[62]
Unterdessen war das zunächst vierstimmige Geläute des Schlosses Thannhausen schon im April 1915 dezimiert worden, als eine – seit 1913 beschädigte – Glocke aus dem Jahr 1627 der Kriegs-Metallsammlung zugeführt wurde.[63] Die übrigen drei Glocken wurden im Zweiten Weltkrieg in die Kategorie „C“ eingereiht und waren daher grundsätzlich Ablieferungskandidaten. Auch in diesem Fall beantragte Semetkowski ein ‚Upgrade‘ in die „D“-Kategorie.[64] Nichtsdestotrotz musste Schlossherr Gordian Gudenus Anfang Mai 1943 jeden Tag mit der Räumung der Glockenstube durch die Kreishandwerkerschaft rechnen. Daher läutete er die Glocken zum Abschied (vermeintlich) ein letztes Mal, um danach Klöppel und Stricke zu entfernen. Es war eine wehmütige Arbeit!, wie er in seinem späteren Dankschreiben an den Gaukonservator bekannte.[65] Gudenus' Dankbarkeit lag darin begründet, dass in Thannhausen statt der angekündigten Handwerker eine Nachricht Semetkowskis eingetroffen war, wonach Berlin im letzten Moment die vorläufige Belassung aller drei Glocken des Schlosses verfügt hatte.[66] De facto sollte diese Entscheidung bis zum Kriegsende 1945 aufrecht bleiben.
Anmerkungen
[1] L(eopold) Beckh-Widmanstetter, Denkstein Sigmund's von Wildenstein im Schlosse Wildbach in Steiermark. In: MZK 18 (1873), 250–253, hier 250; Rupert Pitter, Wildbach. Geschichte eines weststeirischen Edelhofes. In: BlHk 8 (1930), 13–27, hier 27; Helga Kostka, Wildbach. Ein weststeirisches Schloss (Graz 2003), 11, 25; Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs: Steiermark (ohne Graz), bearb. von Kurt Woisetschläger und Peter Krenn (Wien 2013) [in Folge: Dehio Steiermark], 618f.
[2] Peter Krenn, Die Oststeiermark. Ihre Kunstwerke, historischen Lebens- und Siedlungsformen (Graz 1997) [in Folge: Krenn, Oststeiermark], 288–291; Dehio Steiermark 558f.; Gottfried Allmer, Gemeinde Thannhausen (Thannhausen bei Weiz 2019) [in Folge: Allmer, Thannhausen], 188–196.
[3] Krenn, Oststeiermark 289; Dehio Steiermark 558; Allmer, Thannhausen 188.
[4] Soweit dem Verfasser bekannt, existiert nur eine Zeitungsnotiz (1923), in der die Inschrift der Wildbacher Glocke wiedergegeben wird. Diese Meldung basiert wiederum auf einer Zuschrift des Pfarrers von (Bad) Gams, Rupert Pitter. Grazer Volksblatt (10. 7. 1923), 6 („Glockeninschriften in Gams bei Frauenthal“).
[5] Freundliche Mitteilung von Frau Rotraut Egner (Graz/Wildbach).
[6] D retrograd.
[7] Sic!
[8] Irrig anstelle von Streckfuß.
[9] Joseph Wastler, Die kaiserliche Erzgießhütte und die Rothgießer in Grätz. In: MZK, N. F. 15 (1889), 1–11, 97–102, 181–185, 234–237, 265f. [in Folge: Wastler, Erzgießhütte], hier 10f.; Josef Wastler, Der Bronzeguss und dessen Meister in Steiermark. In: Culturbilder aus Steiermark (Graz 1890), 207–227 [in Folge: Wastler, Bronzeguss], hier 214; Jörg Wernisch, Glockenkunde von Österreich (Lienz 2006) [in Folge: Wernisch, Glockenkunde], 171.
[10] Der Verfasser dankt Frau Rotraut Egner und Herrn Dr. Wilfried Egner für die Ermöglichung der Glockenaufnahme. – Belege zur Glocke: BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 11, Fasz. 1943; Grazer Volksblatt (10. 7. 1923), 6 („Glockeninschriften in Gams bei Frauenthal“).
[11] Gewichtsangabe nach BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 11, Fasz. 1943.
[12] Kein Abstand zwischen 9 und M.
[13] Quellen und Literatur zur Glocke (in Auswahl): StLA, A. Göth, K. 51/H. 1254 (Vorau); Augustin Rathofer, Geschichte des Chorherrenstiftes Vorau, Bd. 3 (1871), p. 144f. [StiA Vorau, Hs. 328]; DAGS, Glockensachen 1917; Wastler, Erzgießhütte 11; Wastler, Bronzeguss 214; Andreas Weißenbäck/Josef Pfundner, Tönendes Erz. Die abendländische Glocke als Toninstrument und die historischen Glocken in Österreich (Graz–Köln 1961) [in Folge: Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz], 157, 512; Krenn, Oststeiermark 296; Wernisch, Glockenkunde 171 (mit Abb.), 934 (mit Abb.); Meinhard Brunner/Helfried Valentinitsch †, Mittelalterliche und frühneuzeitliche Glockeninschriften am Beispiel der Bezirke Hartberg und Weiz. In: Meinhard Brunner/Gerhard Pferschy u. a. (Red.), Rutengänge. Studien zur geschichtlichen Landeskunde. Festgabe für Walter Brunner zum 70. Geburtstag (= Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 54, = ZHVSt, Sonderbd. 26, Graz 2010), 124–152, hier 133; Jörg Wernisch, Glockenverzeichnis von Österreich (Lienz [2011]) [in Folge: Wernisch, Glockenverzeichnis], 189, 251; Dehio Steiermark 592.
[14] Gewichtsangabe nach Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz 512.
[15] Z retrograd.
[16] Z retrograd.
[17] Sic!
[18] Ferdinand Hutz, 800 Jahre Marktkirche Vorau 1202–2002 (= Vorauer Heimatblätter 25, Vorau 2002), 34; Ferdinand Hutz, Orgel und Glocken der Marktkirche Vorau. In: BlHk 76 (2002), 55–61, hier 59f.
[19] Ferdinand Hutz, Das Augustiner-Chorherrenstift Vorau zur Zeit der Reformation und Gegenreformation (Diss. Graz 1977), 13f.
[20] Der Verfasser dankt Herrn P. Stephan Varga für die Ermöglichung der Glockenaufnahme. – Quellen und Literatur zur Glocke: Clemens Johann Brandtner, Beiträge zur Geschichte der Reiner Stiftspfarren (Gratwein 1979), 39f. – Andere Belege geben irrig „1555“ als Gussjahr an: Ulrich Greiner, Ein Beitrag zur Geschichte der Glockengießerei in Gratz. Eine Sammlung von circa 80 Glockeninschriften, aufgenommen im Umkreise des Stiftes Rein (1864) [StLA Hs. 1039] [in Folge: Greiner, Glockengießerei], p. 29; Wastler, Erzgießhütte 10f.; Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz 157, 508; Wernisch, Glockenkunde 171; Wernisch, Glockenverzeichnis 183; Dehio Steiermark 543. – Gussjahr „1553“: Wastler, Bronzeguss 214. – Bereits mit der Vermutung, die Jahreszahl könnte richtig „1565“ lauten: DAGS, Glockenakten 1945–1952: 12. 7. 1948.
[21] Gewichtsangabe nach DAGS, Glockenakten 1945–1952: 12. 7. 1948.
[22] Sic!
[23] Sic!
[24] Sic!
[25] Der Verfasser dankt Herrn Erwein Gudenus für die Ermöglichung der Glockenaufnahme.
[26] Z retrograd.
[27] Z retrograd.
[28] Sic!
[29] Sic!
[30] Sic!
[31] Alle N retrograd.
[32] Vgl. N. N., Die Wachsenecker Schloßruinen (= Ansichten aus der Steiermark mit vorzüglicher Beachtung der Alterthümer und Denkwürdigkeiten, als: Burgen, Schlösser, Kirchen u.s.w., Heft 37, Graz [o. J.]), 1–4 [in Folge: N. N., Wachsenecker Schloßruinen], hier 4; Leopold Farnleitner/Franz Hauser u. a., Weiz. Geschichte und Geschichten (Weiz 1997), 44, 48; Allmer, Thannhausen 196.
[33] N. N., Wachsenecker Schloßruinen 4; Martin Moll, Land und Herrschaft im Oberen Feistritztal. In: Robert F. Hausmann (Hg.), Land um Birkfeld. Zur Geschichte des Oberen Feistritztales (Birkfeld 1993), 13–26, hier 17.
[34] Krenn, Oststeiermark 78; Dehio Steiermark 604.
[35] Angelika Christine Halbedl-Herrich, Die Trauungs- und Sterbematriken der evangelischen Stiftskirche Graz im 16. Jahrhundert. Eine Textedition (Diss. Graz 2015) [in Folge: Halbedl-Herrich, Trauungs- und Sterbematriken], 271, Nr. 1071.
[36] Halbedl-Herrich, Trauungs- und Sterbematriken 265, Nr. 1019
[37] Wernisch, Glockenkunde 171, 741f.; Wernisch, Glockenverzeichnis 307.
[38] Wernisch, Glockenkunde 171; Wernisch, Glockenverzeichnis 179.
[39] Diese Glocke wurde 1873 in Graz eingeschmolzen. Greiner, Glockengießerei, p. 44a; Wastler, Erzgießhütte 11.
[40] Für diese Glocke finden sich in der Literatur drei verschiedene Gussjahre: Wastler, Bronzeguss 214 [„1553“]; Wastler, Erzgießhütte 11 [„1555“]; Georg Göth, Das Herzogthum Steiermark. Geographisch, statistisch, topographisch dargestellt und mit geschichtlichen Erläuterungen versehen, Bd. 3 (Wien 1843), 277 [„1566“]. – Sie war jedenfalls 1917 nicht mehr vorhanden. BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 6, Fasz. 3.
[41] Die überlieferte Glockeninschrift aus Hitzendorf nennt u. a. den Gießer „JERG WENIG“ und die Datierung „1506“. N. N., Notizen [Hitzendorf]. In: Der Kirchen-Schmuck. Blätter des christlichen Kunstvereines der Diöcese Seckau 10 (1879), 71f.; Wastler, Erzgießhütte 11. – Wie bereits von F. Popelka erkannt, dürfte es sich hierbei um einen Gussfehler handeln, der zu dem Ziffernsturz „1506“ statt richtig „1560“ geführt hat. Fritz Popelka, Eine rätselhafte Glockeninschrift in Hitzendorf. In: BlHk 1/1 (1923), 8.
[42] Siehe Wastler, Erzgießhütte 8, Anm. 3.
[43] [Arnold] Luschin, Rückblicke auf die culturhistorische Ausstellung vom Sommer 1883 (V.). In: Tagespost (Abendblatt), Nr. 239 (4. 9. 1884), [1–3] [in Folge: Luschin, Rückblicke]; Wastler, Erzgießhütte 8–11, 265; Wastler, Bronzeguss 215; Wernisch, Glockenkunde 164f.
[44] Luschin, Rückblicke [1]; Wastler, Erzgießhütte 9; Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs: Graz, bearb. von Horst Schweigert (Wien 1979), 54; Wernisch, Glockenkunde 165.
[45] Wastler, Bronzeguss 215–217; Wastler, Nachrichten 182; Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz 157f., 206; Wernisch, Glockenkunde 223.
[46] Wastler, Erzgießhütte 10f.; Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz 206; Wernisch, Glockenkunde 223.
[47] Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz 157f., 482f.; Wernisch, Glockenkunde 165; Wernisch, Glockenverzeichnis 190f.
[48] Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz 158, 475; Krenn, Oststeiermark 103; Wernisch, Glockenkunde 165; Wernisch, Glockenverzeichnis 184.
[49] DAGS, Glockensachen 1917; Erich Linhardt, 500 Jahre Tobelbad. Eine Geschichte der ehemaligen Kuranstalt Tobelbad und des gleichnamigen Ortes sowie der damit in Verbindung stehenden Siedlungen und Einrichtungen (Tobelbad 1991), 82.
[50] Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz 158, 507; Wernisch, Glockenverzeichnis 356.
[51] Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz 158, 307; Dehio-Handbuch. Die Deutschen Kunstdenkmäler Österreichs: Kärnten, basierend auf den Vorarbeiten von Karl Ginhardt neu bearbeitet von Ernst Bacher, Ilse Friesen u. a. (Wien 32001), 1082; Wernisch, Glockenkunde 165, 1063; Wernisch, Glockenverzeichnis 81, 366.
[52] Weißenbäck/Pfundner, Tönendes Erz 206, 387; Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs: Niederösterreich nördlich der Donau, bearb. von Evelyn Benesch, Bernd Euler-Rolle u. a. (Wien 1990), 1012; Wernisch, Glockenkunde 223; Wernisch, Glockenverzeichnis 134.
[53] Ferdinand Hutz, Miesenbach in Vergangenheit und Gegenwart (Miesenbach 2003), 62, 192.
[54] DAGS, Pfarrchronik Stubenberg, p. 26.
[55] Othmar Wonisch, Ein steirisches Glockenjubiläum. In: Murtaler Zeitung (23. 10. 1937), 6; Wernisch, Glockenkunde 165.
[56] Vgl. StLA, A. Göth, K. 47/H. 1072 (Semriach); Greiner, Glockengießerei, p. 19.
[57] Greiner, Glockengießerei, p. 6f.; Wastler, Erzgießhütte 9; Wastler, Bronzeguss 216.
[58] Freundliche Mitteilung von DI Wilhelm Luttenberger (Graz). – Vgl. BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 6, Fasz. 2; DAGS, Glockensachen 1917.
[59] Zur Organisation der Glockenablieferungen im Ersten und Zweiten Weltkrieg siehe: Meinhard Brunner, Dem „Heldentod“ entronnen. Die Rückführung von abgelieferten Glocken in die Steiermark nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. In: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 109 (2018), 217–245, hier 217–221.
[60] Überlieferte Glockeninschrift: LAVDATE DEVM IN CYMBALIS 1583. BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 11, Fasz. 1943.
[61] BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 10, Fasz. 1941: 10. 12. 1941.
[62] BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 11, Fasz. 1943: 21. 5. 1943 und 26. 5. 1943 sowie 4. 5. 1943.
[63] Grazer Volksblatt (23. 4. 1915), 6. – Überlieferte Glockeninschrift: GEORGIUS JANES ME CURAVIT FIERI 1627. Schloss Thannhausen, Glockenakten.
[64] BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 10, Fasz. 1941: 15. 9. 1941.
[65] BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 11, Fasz. 1943: 13. 5. 1943.
[66] Vgl. BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 9, Fasz. 5: 12. 5. 1943; BDA Wien, Archiv, Glocken, K. 11, Fasz. 1943: 4. 5. 1943. – Die offizielle Mitteilung aus Berlin, dass die drei Thannhausener Glocken an Ort und Stelle bleiben können, traf am 19. Mai 1943 beim Landrat des Kreises Weiz ein. Von diesem wurde Gordian Gudenus mit Schreiben vom 1. Juni 1943 informiert. Schloss Thannhausen, Glockenakten: 1. 6. 1943.
Mag. Dr. Meinhard Brunner, geb. 1971 in Judenburg, Studium der Geschichte und Volkskunde an der Karl-Franzens-Universität Graz. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Landeskommission für Steiermark.
Forschungsschwerpunkte: Sammlung und Edition der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Inschriften der Steiermark; Historische Glockenforschung; Britische Militärgerichte in Österreich 1945–1955.