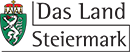8. Mai 1945: Stunde null?
Helmut Konrad

Die Eingangsfrage ist natürlich rein rhetorisch. Menschen, die am 7. Mai 1945 bei uns, in Europa und in der Welt gelebt haben, waren zum allergrößten Teil auch am 9. Mai unter den Lebenden. Ihr Denken und Fühlen, ihr Weltbild und ihre Loyalitäten, all das ging über die historische Bruchlinie hinaus. Und auch nach dem 8. Mai starben Verwundete in den überfüllten Krankenhäusern, Kriegsgefangene befanden sich in Lagern und auch der Krieg ging weiter: Im Pazifik sollte er noch Monate dauern und die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki waren noch nicht gefallen.
Dennoch: Welthistorisch stellt dieser 8. Mai einen Einschnitt dar, wie es ihn seit dem Ende des Ersten Weltkriegs nicht gegeben hatte. Er war sogar noch wesentlicher, er manifestierte das Ende des „Dreißigjährigen Krieges”, wie der bekannte Historiker Eric Hobsbawm die Zeitspanne von 1914 bis 1945 bezeichnet.
Das Kriegsende und die Neuordnung der Welt ist aber insgesamt ein Prozess, der etwa vier Jahre dauerte, bis sich der tatsächliche Wechsel vollzogen und die neuen Strukturen sich verfestigt hatten. Man könnte bei Stalingrad beginnen, sicher aber besaßen die Alliierten ab Oktober 1943 die Gewissheit, den Krieg zu ihren Gunsten entscheiden zu können. Die Moskauer Deklaration vom Oktober/November 1943 mit der für Österreichs Zukunft so wichtigen Passage (auf die später noch eingegangen werden soll) schmiedete die Anti-Hitler-Allianz noch einmal fester und diskutierte auch schon Nachkriegsentscheidungen.
Am 27. Jänner 1945 befreiten sowjetische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz. Völlig zu Recht gilt dieser Tag seither als internationaler Gedenktag, denn nunmehr konnte in der Weltöffentlichkeit niemand mehr das Verbrecherische am Nationalsozialismus in Frage stellen. Die Befreiung des Lagers war nicht kriegsentscheidend, aber sie bestärkte die Kampfbereitschaft gegen ein verbrecherisches Regime. Das sollte sich drei Wochen später in Jalta auf der Halbinsel Krim bestätigen. Churchill und Roosevelt zeigten sich Stalin gegenüber höchst kompromissbereit, wollten sie doch die Sowjetunion zur Teilnahme am Krieg im Pazifik bewegen. Die Außenminister der Sowjetunion, Großbritanniens und der USA unterzeichneten am 11. Februar 1945 das Schlussdokument, in dem ganz wesentliche Punkte für die Nachkriegsweltordnung enthalten waren. Eine Weltorganisation sollte künftige Kriege vermeiden, Deutschland sollte zerstückelt werden, Reparationen sollten verlangt und die Hauptkriegsverbrecher vor ein Gericht gestellt werden.
Wesentlich waren aber die Resultate der Gespräche über die künftige Machtaufteilung in Europa zwischen dem Westen und der Sowjetunion. Churchill hatte auf einem Blatt Papier folgende Lösungsvorschläge notiert, die Stalin jeweils mit einem Haken bestätigte:
Rumänien: Sowjetunion 90 % – die anderen 10 %
Griechenland: Großbritannien 90 % – Sowjetunion 10 %
Jugoslawien: 50 % – 50 %
Ungarn: 50 % – 50 %
Bulgarien: Sowjetunion 75 % – die anderen 25 %

Man kann deutlich sehen, wie viele der Konflikte der Folgejahre durch diese Vorgaben bereits grundgelegt waren und wie mit einem Federstrich wieder über das Schicksal der Menschen in Zentral- und Osteuropa hinweggegangen wurde.
Richtet man den Blick auf jene Region, die damals „Ostmark” genannt wurde und die sehr bald wieder Österreich werden sollte, so überschritten weniger als sieben Wochen nach dem Abschluss der Konferenz von Jalta, und zwar am 29. März 1945, sowjetische Truppen erstmals die Staatsgrenze. Mit der abenteuerlichen Kontaktaufnahme von Karl Renner, der schon bei der Gründung der Ersten Republik an der Spitze gestanden war, mit den Sowjets und schließlich mit Stalin sollte sich das Schicksal des Landes entscheiden. Stalin glaubte, im alten und eitlen Austromarxisten Renner eine leicht zu dominierende Marionette sehen zu können, Renner hingegen war entschlossen, Stalin zu umgarnen und dann den sowjetischen Einfluss zu minimieren. Noch während der blutigen Schlacht um Wien, als der Stephansdom brannte und am Spitz in Floridsdorf die Offiziere Karl Biedermann, Alfred Huth und Rudolf Raschke an Laternenpfählen aufgehängt wurden (mit Plakaten um den Hals: „Ich habe mit den Bolschewiken paktiert”), noch während Tausende Jüdinnen und Juden auf den berüchtigten Todesmärschen starben, hatten sich die demokratischen Parteien und die Gewerkschaften konstituiert. Am 27. April 1945 wurde die Republik ausgerufen und die Provisorische Regierung Renner nahm ihre Arbeit auf.
Aber in weiten Teilen Österreichs war weiterhin Krieg. Die sowjetischen Truppen drangen mit blutigen Schlachten durch die Oststeiermark in Richtung Graz vor, sie erreichten die Stadt erst am 8. Mai. In Kärnten kämpften sich die Briten voran, und durch Oberösterreich zogen die Amerikaner nach Osten: Sie erreichten das Konzentrationslager Mauthausen am 5. Mai, mehr als eine Woche nach der Ausrufung der Republik. – Grausame Endzeitverbrechen und erste demokratische Schritte liefen also zeitgleich.
Zurück zur Weltpolitik: Adolf Hitler, den die Alliierten, vor allem die Amerikaner, in der – freilich nur in den Köpfen vorhandenen – „Alpenfestung” vermuteten und die daher sogar den Plan hatten, Salzburg in Schutt und Asche zu legen, hatte sich in Berlin in den Führerbunker zurückgezogen. Am 29. April 1945 verfasste er dort ein privates und ein politisches Testament. Privat gab er bekannt, dass er Eva Braun ehelichen werde, dass er die Gemälde nie für sich, sondern für ein Museum in Linz gesammelt hatte und dass er und seine Frau, „um der Schande des Absetzens oder der Kapitulation zu entgehen”, Selbstmord begehen werden. Im politischen Testament schob er die Schuld am Krieg von sich. „Er wurde gewollt und angestiftet ausschließlich von jenen internationalen Staatsmännern, die entweder jüdischer Herkunft waren oder für jüdische Interessen arbeiteten.” Privat ordnete er noch an, dass die Leichen verbrannt werden sollten. Sogar der Hund Blondie musste zum Test herhalten, ob die Giftkapsel auch funktioniere. Eva Braun starb am 30. April 1945 durch Gift, Adolf Hitler erschoss sich. Joseph Goebbels und seine Frau vergifteten zuerst die Kinderschar und dann sich selbst. Die Medien verbreiteten, Hitler sei im Kampf gegen den Bolschewismus, den er „bis zum letzten Atemzug” geführt hätte, einen Heldentod gestorben.
Die Geschicke des untergehenden Reiches übernahm, wie es Hitler in seinem Testament angeordnet hatte, Großadmiral Karl Dönitz. Vom 2. Mai 1945 an „regierte” er einen Zwergenstaat in der Marineschule Mürwick bei Flensburg. Der Staat war letztlich ein fünf Kilometer langer Streifen am Rande der Flensburger Förde, doch Dönitz sprach vom Wiederaufbau, von der Notwendigkeit einer neuen Geheimpolizei und beriet über neue Grußformeln, da der „Hitlergruß” ja obsolet geworden war. Sechs Tage nach seiner „Machtübernahme” musste Dönitz die Kapitulation unterzeichnen, zwei Wochen später war es mit seinem Kleinstaat zu Ende.
Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht rund um den 8. Mai deutete schon auf die Spannungen der Folgejahre hin. Dönitz hatte Generaloberst Jodl als Chef des Wehrmachtführungsstabs autorisiert, am 7. Mai in Reims die Kapitulationsurkunde zu unterzeichnen, nach der die Kapitulation am 8. Mai um 23:01 Uhr in Kraft treten sollte. Weil aber bei dieser Unterzeichnung die sowjetischen Vertreter nur Randfiguren waren, musste die Zeremonie am 8./9. Mai im Hauptquartier der Roten Armee in Berlin-Karlshorst durch Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel erneut vollzogen werden. Hier waren nun die Westmächte die Zaungäste. Bis heute zieht sich der Termin über die Gedenkfeiern durch die politische Diskussion. Aber: Der 8. Mai ist der „Victory Day”, das Ende des nationalsozialistischen Deutschlands, von so vielen erhofft, war endlich Realität geworden.

In Österreich hatte inzwischen die Regierung Renner bereits ihre Arbeit aufgenommen. Die Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945, in der der „dem österreichischen Volke aufgezwungene Anschluss” für „null und nichtig” erklärt wurde, hat neben ihren fünf Artikeln eine lange Präambel, die den Versuch unternimmt, die „Opferthese”, auf der das Nachkriegsverständnis Österreichs aufbauen sollte, umfangreich zu begründen. Kein Wort ist dort von den über 60.000 ermordeten österreichischen Juden zu lesen, nichts von den Arisierungen und den Vertreibungen. Roma und Sinti finden keine Erwähnung, auch die slowenischen Österreicher werden verschwiegen. Alles, was 1938 geschehen ist, scheint gegen den Willen der Österreicher geschehen zu sein, aufgezwungen und ein „Missbrauch” durch Hitler und das nationalsozialistische Deutschland. Am 1. Mai 1945 trat die Erklärung in Kraft.
In den österreichischen Bundesländern gab es anfangs Skepsis gegenüber der Regierung Renner, man betrachtete sie als eine Regierung „von Stalins Gnaden”. Die Salzburger Landesregierung, die am 24. Mai eine Begrüßungsnote an die Bundesregierung sandte, wurde sogar vom amerikanischen Militärbefehlshaber verwarnt. Der Alliierte Rat, der Österreich kontrollierte, erlaubte aber der Regierung Renner, die Vertreter aller Bundesländer vom 24. bis zum 26. September 1945 zur Länderkonferenz ins Niederösterreichische Landhaus in Wien zu laden. Dort wurde die Regierung für ganz Österreich anerkannt, was der Alliierte Rat am 20. Oktober bestätigte. Der Weg war frei für Wahlen, die schließlich am 25. November 1945 stattfanden. Drei Parteien waren zugelassen, 600.000 „Ehemalige” durften nicht wählen. Die KPÖ, die sich dadurch, dass es die Sowjetunion war, die Wien befreit hatte, großen Zuspruch erwartete, erhielt nur 5,5 %. Wahlsieger war die ÖVP mit 49,8 %, die SPÖ erhielt 44,6 %. Das deutet den Weg an, den die Zweite Republik längerfristig einschlagen sollte.
Die Neuordnung Europas war aber mit dem Ende des „heißen” Krieges jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Siegermächte wollten sich in Berlin treffen, dieser Ort war am symbolträchtigsten, aber wegen der gewaltigen Zerstörungen auch bei den Repräsentativbauten wich man nach Potsdam aus. Am 17. Juni 1945 startete die Potsdamer Konferenz. Die handelnden Personen waren zumindest teilweise neu: Roosevelt war im April gestorben, und Churchill hatte gerade die Unterhauswahlen in England verloren. Er wurde während der Konferenz von Clemens Attlee, dem Labour-Mann, abgelöst. Nur Stalin war von den „Großen Drei” in Potsdam noch dabei, und es war offensichtlich, dass er die Fäden ziehen konnte. Zudem hatten die USA den Krieg im Pazifik zu führen, der noch nicht entschieden war und an dem sich die Sowjetunion zumindest vorerst nicht beteiligen wollte.
Über die politische Gestaltung Nachkriegsdeutschlands war man sich rasch einig. Es galten die „4 D”: Denazifizierung, Demilitarisierung, Demokratisierung und Dezentralisierung. Letzteres bedeutete die Aufteilung in die vier Besatzungszonen. Die Fragen der neuen Grenzen in Europa waren aber wesentlich komplexer. Während Österreich fast diskussionslos die Grenzen von 1938 (nur Jugoslawien stellte vergebens Gebietsansprüche) erhielt, ging es in Potsdam um die Westverschiebung Polens bis zur Oder-Neiße-Linie (dass es zwei Flüsse namens Neiße gab, war den Westmächten nicht bewusst), also auch um Ostpreußen und das symbolisch so bedeutende Königsberg. Stalin konnte sich durchsetzen. Das hatte letztlich die Konsequenz, dass 15 Millionen Menschen mit deutscher Muttersprache, die im neu geschaffenen Polen, in der Tschechoslowakei oder in anderen osteuropäischen Staaten lebten (bei Kriegsende waren es immerhin noch über 7 Millionen), „in ordnungsgemäßer und humaner Weise”, wie es im Potsdamer Abkommen hieß, ausgesiedelt werden sollten. Von den inhumanen Vertreibungen erzählen aber noch heute viele Familiengeschichten in Deutschland und Österreich.
Der Zweite Weltkrieg wurde allerdings auch in Potsdam nicht beendet. Im Pazifik wurde weiter erbittert gekämpft. Dabei hatte der Krieg im Pazifik schon vor dem Krieg in Europa begonnen. Seit dem 7. Juli 1937 tobte der Krieg Japans mit China. Japans Vorgehen in eroberten Gebieten (Korea, Mandschukuo) war ähnlich brutal wie das der Deutschen in Osteuropa, Hunderttausende wurden als Zivilisten Opfer der Gewalt. Mit dem Angriff auf die US-amerikanische Flotte (7. Dezember 1941), die auf Hawaii in Pearl Harbor stationiert war, weitete sich der Krieg zu einem langen Ringen zwischen Japan und den USA aus. Die Sowjetunion hatte mit Japan seit dem 13. April 1941 einen Nichtangriffspakt, erklärte aber am 8. August 1945 Japan den Krieg, um Mandschukuo und die Kurilen für sich einnehmen zu können. Das war zwei Tage, nachdem die Amerikaner die Atombombe über Hiroshima abgeworfen hatten, als klar war, wie der Krieg enden würde.
Der erstmalige Abwurf eine Atombombe stellt einen welthistorischen Einschnitt dar. „Little Boy”, wie die Bombe euphemistisch genannt wurde, zerstörte die Stadt und tötete 80.000 Menschen; die Spätfolgen sind dabei noch nicht berücksichtigt. Eine Waffe mit dieser Wirkung hatte die Welt noch nicht gesehen. Japan war in Schockstarre. Drei Tage später fiel die nächste Atombombe auf Nagasaki, es starben 40.000 Menschen. Mit den Spätfolgen sind diese Zahlen zumindest zu verdoppeln. Es dauerte aber nochmals sechs Tage, bis Kaiser Hirohito die Beendigung des Krieges bekanntgab. Am 2. September 1945 unterzeichnete Japan die Kapitulationsurkunde. Der Zweite Weltkrieg war damit zu Ende, die Waffen schwiegen.
Die Konflikte in der Welt gingen aber weiter. Am 12. März 1947 hielt der US-amerikanische Präsident Harry S. Truman vor dem US-Kongress jene Rede, die als „Truman-Doktrin” in die Geschichte eingehen sollte. Er sagte dabei sowohl für Griechenland als auch für die Türkei Hilfe zu, um einer drohenden kommunistischen Machtübernahme zu entgehen. Es ging ab sofort darum, jede weitere Expansion von Stalins Sowjetunion zu verhindern. Das war das definitive Ende der Kriegskoalition und der Beginn des Kalten Krieges. Die Truman-Doktrin konnte die kommunistische Machtübernahme 1948 in der Tschechoslowakei nicht verhindern. Mit dem am 7. Juni 1947 beschlossenen Marshallplan gelang es aber, die westorientierten Staaten Kontinentaleuropas, darunter auch die „Auslage” Österreich, auf ein liberal-demokratisches und marktwirtschaftliches Weltbild festzulegen.
Diese kurze Übersicht hat sich auf die weltpolitischen Entscheidungen beschränkt. Nicht eingegangen wurde auf das menschliche Leid, auf die Opfer und auf die emotionalen Erschütterungen, die dieser Krieg hinterlassen hatte. Der Holocaust, jenes grausamste Ereignis des letzten Jahrhunderts, fand nur Erwähnung bei der Befreiung der Lager. Die von besonders schweren Rahmenbedingungen geprägte Geschichte der Frauen in dieser Zeit bedarf einer eigenen Darstellung. In seiner chronologischen Gestaltung bietet der hier vorgelegte historische Abriss nur einen Rahmen für die Zuordnung der unzähligen Leidensgeschichten, die diesen Zeitraum mehr charakterisieren als die Entscheidungen der großen Politik.
Em. Univ.-Prof. Dr. h. c. Dr. Helmut Konrad, geb. 1948, studierte Geschichte und Germanistik an der Universität Wien, von 1984 bis 2016 Professor für Allgemeine Zeitgeschichte an der Karl-Franzens-Universität Graz, von 1993 bis 1997 Rektor der Karl-Franzens-Universität, seit 1996 Mitglied der HLK.
Forschungsschwerpunkte: Geschichte des 20. Jahrhunderts, Kulturgeschichte, Sozialgeschichte, Arbeitergeschichte, Institutionengeschichte, Erster Weltkrieg, Entwicklung universitärer Qualitätssicherungssysteme.