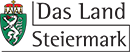Der Schneeweißpavillon im Steirischen Wechselland – Entstehung, Nutzung und Wiedererrichtung eines regionalen Kulturdenkmals*
Andreas Salmhofer
Im Schneeweißpavillon verdichten sich mehrere Aspekte der regionalen Kultur-, Sozial- und Architekturgeschichte des Steirischen Wechsellandes. Das Bauwerk steht exemplarisch für die Verbindung von wirtschaftlicher Entwicklung, gesellschaftlichem Leben und ästhetischen Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts. Seine wechselvolle Geschichte – von der Entstehung im Umfeld der Eisenbahnerweiterung über den Wandel der Nutzungsformen bis hin zur denkmalpflegerischen Wiedererrichtung – spiegelt die Transformation regionaler Identität und Baukultur über mehr als ein Jahrhundert hinweg wider.
Vorgeschichte und Errichtung

Nachdem 1905 der Bau der Eisenbahnstrecke von Hartberg nach Friedberg abgeschlossen war, wurde in den folgenden Jahren intensiv über die Weiterführung der Bahnlinie in Richtung Wien diskutiert. Zwei Trassenvarianten standen zur Auswahl: eine günstigere Strecke von Friedberg über Schäffern nach Aspang mit zwei Tunneln oder eine aufwendigere Verbindung über Tauchen am Wechsel mit fünf Tunneln. Durch das entschlossene Eintreten dreier regional bedeutender Betriebe – des Forstbetriebs bei der ehemaligen Glashütte Schaueregg, der Watzke-Fabrik in Pinggau sowie des Weißerde- bzw. Kaolinwerks bei Aspang – fiel die Entscheidung auf die Strecke über Tauchen am Wechsel. Diese Verbindung wurde schließlich zwischen 1908 und 1910 realisiert und führte über den neu errichteten Bahnhof Tauchen-Schaueregg nach Aspang.[1] Dadurch wurde zwischen den Ortszentren von Friedberg und Pinggau ein eigener Bahnhof gebaut, der zwar näher am Stadtzentrum Friedberg lag, jedoch auf Gemeindegrund von Pinggau stand und daher als Bahnhof Friedberg-Pinggau (später Bahnhof Pinggau-Markt) bezeichnet wurde.
Das Gebiet entlang der steilen Straße zwischen Pinggau und Friedberg entwickelte sich in den Jahren 1908 bis 1910 – und auch noch in der Zeit bis zum Ersten Weltkrieg (1914–1918) – zu einem kleinen wirtschaftlichen Zentrum. Rund um den neu errichteten Bahnhof entstand ein regelrechter Bauboom: Neben mehreren Wohn- und Betriebsgebäuden wurden auch zwei Gaststätten eröffnet: 1908 die „Restauration Josef Schneeweiss” (später „Gasthaus Schneeweiß”[2]) und 1909 der „Gasthof zur Wechselbahn” (später „Gasthof Endl”).[3] Diese Betriebe trugen wesentlich dazu bei, dass sich das Bahnhofsareal zu einem belebten Treffpunkt für Reisende und Einheimische entwickelte.
Das „Gasthaus Schneeweiß“ und der Schneeweißpavillon bis in die 1950er-Jahre




Die Gründer des Gasthauses Schneeweiß, Josef Schneeweiß (geb. 1878) und seine Frau Maria, geb. Strobl (geb. 1883), ließen im Jahr 1910 auf dem Bahnhofsvorplatz einen eleganten Pavillon errichten, der nicht mit dem Gasthaus verbunden war. Der sogenannte Schneeweißpavillon wurde rasch zu einem beliebten Treffpunkt und entwickelte sich – gemeinsam mit dem Gasthaus – zu einem gesellschaftlichen Mittelpunkt der Region. Hier fanden Sommerfeste, Tanzveranstaltungen und Hochzeitsfeiern statt, die Gäste aus Friedberg, Pinggau und der weiteren Umgebung anzogen.
In der familiären Überlieferung wird der Schneeweißpavillon als Jugendstilpavillon, Laube oder Salettl bezeichnet. Das Bauwerk misst rund 10 Meter in der Länge, 4,5 Meter in der Breite und etwa 3,9 Meter in der Höhe. Am ursprünglichen Standort beim Gasthaus Schneeweiß führten drei Stufen zum Eingang des Pavillons. Ab den 1920er-Jahren umsäumten den Pavillon einige Bäume. Das Bauwerk selbst ist ein symmetrischer, filigraner Holzbau mit Satteldach, mit offener Südseite, großen Glasflächen und kunstvoll gearbeiteten Zierelementen, charakteristisch für Garten- und Sommerpavillons des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Wer den Pavillon entworfen oder errichtet hat, ist nicht überliefert. Im Raum Pinggau-Friedberg existierten jedoch um 1900 mehrere ähnliche Bauten, die stilistisch dem Jugendstil zugeordnet werden können. Ob zwischen diesen Gebäuden gestalterische oder handwerkliche Verbindungen bestanden, lässt sich heute nicht mehr eindeutig klären. Beispielsweise erhielt das „Gasthaus Großschedl” (später „Gasthaus Stögerer” bzw. „Hubertushof”) am Friedberger Hauptplatz um 1900 einen grün gestrichenen Anbau mit typischen Jugendstilelementen, der in seiner Formensprache an den Schneeweißpavillon erinnerte, jedoch um 1945 abgetragen wurde. Auch das Gasthaus Gassner (später „Schwarzer Adler” [Familie Gressenbauer]) verfügte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts über einen Zubau, der meistens auch dem Jugendstil zugerechnet wird.
Der Gastwirtssohn und spätere Künstler Josef Schneeweiß (1913–1990) erinnerte sich in einem Radiointerview aus dem Jahr 1985, dass bei den damaligen Zusammenkünften im Gasthaus Schneeweiß sowohl regional als auch überregional bekannte Persönlichkeiten anwesend waren. Dazu zählten unter anderen der Schriftsteller Anton Wildgans (1881–1932), der regelmäßig in Mönichkirchen weilte, sowie der Kunsthistoriker Fortunat von Schubert-Soldern (1867–1953), der von 1928 bis 1931 als erster Präsident des Bundesdenkmalamtes fungierte, und dessen Sohn, der Zoologe Rainer Schubert-Soldern (1900–1974). Neben diesen angesehenen Gästen waren jedoch auch drei umstrittene Persönlichkeiten zugegen, die in literarischer Hinsicht als Wegbereiter nationalistischer Ideologien gelten können: der Pfarrer von Festenburg und deutschnationale Dichter Ottokar Kernstock (1848–1928), dessen patriotische Gedichte später auch NSDAP-Funktionäre in der Oststeiermark beeinflusst haben, sowie der Dramaturg und Schriftsteller Friedrich Schreyvogl (1899–1976) und der Kärntner Dichter Josef Friedrich Perkonig (1890–1959), die beide in den 1930er-Jahren dem Nationalsozialismus nahestanden und den „Anschluss” Österreichs an das Deutsche Reich begrüßten.[4]
In oder bei den Zentren des damaligen gesellschaftlichen Lebens im Steirischen Wechselland pflanzten die Nationalsozialisten in den Wochen nach dem „Anschluss” (März 1938) „Hitler-Bäume”; so ist es nicht verwunderlich, dass dies auch am Bahnhofsvorplatz beim Gasthaus Schneeweiß geschah.
Während der nationalsozialistischen Herrschaft hielt sich im April 1941 Adolf Hitler gemeinsam mit führenden Vertretern der NSDAP und der Wehrmacht – darunter Hermann Göring, Wilhelm Keitel und Heinrich Himmler – am Bahnhof Mönichkirchen auf. Von diesem sogenannten „Führerhauptquartier auf Schienen” aus wurden der Balkanfeldzug sowie weitere militärische Operationen und politische Maßnahmen des Regimes koordiniert. Im weiteren Umfeld dieses mobilen Hauptquartiers, insbesondere entlang der Bahnlinie, waren zahlreiche hochrangige NS-Funktionäre und Offiziere in den umliegenden Orten einquartiert. Auch am Bahnhof Friedberg-Pinggau war – trotz strenger Geheimhaltung – die Präsenz von Angehörigen der NSDAP, der Gestapo und der Wehrmacht deutlich wahrnehmbar; viele von ihnen waren in den Gasthäusern des Steirischen Wechsellandes untergebracht. Da die Bahnstrecke für etwa 14 Tage ab Friedberg-Pinggau aus Sicherheitsgründen gesperrt war, erfolgte von hier aus der Transport von Personen und Material über Busverbindungen und Lastwagen in Richtung Wien. Die Region stand in dieser Zeit unter verstärkter militärischer Kontrolle.
Im Frühjahr 1945 wurden im Steirischen Wechselland unter strenger Aufsicht der SS zahlreiche Schützengräben und andere Verteidigungsanlagen errichtet. An diesen Arbeiten waren Zwangsarbeiter·innen, Angehörige des NS-„Volkssturms” sowie Mitglieder der „Hitlerjugend” beteiligt. Auch im Umfeld des Bahnhofsareals beim „Gasthaus Schneeweiß” wurden Schützengräben angelegt. Da sich jedoch Wehrmacht und SS vor dem Eintreffen der sowjetischen Truppen auf den Hochwechsel, den Semmering und in das Joglland zurückgezogen hatten, wo schließlich schwere Kämpfe stattfanden, kam es im Raum Pinggau-Friedberg zu keinen größeren Zerstörungen.[5]
Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Bahnhof – ebenso wie die umliegenden Gasthäuser – stark von der Besatzungszeit geprägt. Das Bahnhofareal spielte erneut eine wichtige Rolle bei der Abwicklung des Personen- und Warenverkehrs nach Wien. Besonders in den Jahren 1945/46 kam es jedoch immer wieder zu Sperren der Zugverbindungen in Richtung Wien, wodurch zahlreiche Reisende am Bahnhof strandeten. Viele warteten dort auf Weiterreisemöglichkeiten, und auch von Schmuggelaktivitäten ist in zeitgenössischen Erzählungen häufig die Rede.[6]
Entwicklungen bis 2012

Bis in die späten 1990er-Jahre war das Gasthaus Schneeweiß wieder ein zentraler Ort der Begegnung – ein Platz, an dem sich Tradition, Geselligkeit und ländliche Kultur verbanden. Bis in die Mitte der 1980er-Jahre war das Haus ein fester Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in Pinggau und Friedberg und im umliegenden Wechselland. Über Jahrzehnte hinweg diente es als beliebter Treffpunkt für Einheimische und Gäste, wo regelmäßig Sommerfeste, Musikveranstaltungen und Familienfeiern stattfanden.
Ein bedeutender Einschnitt für die gesamte Region war der Bau der A2-Südautobahn, der die touristische Entwicklung im Wechselland nachhaltig veränderte. Durch die neue Verkehrsanbindung verlagerte sich der Reiseverkehr zunehmend, und die Zahl der Sommergäste – der sogenannten „Sommerfrischler”, auf die viele Gasthäuser gesetzt hatten – ging deutlich zurück. Diese strukturellen Veränderungen führten dazu, dass zahlreiche Gaststätten in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerieten. In den 1970er-Jahren entstanden zudem Diskotheken und moderne Ausflugslokale, die den traditionellen Gasthäusern zusätzliche Konkurrenz bereiteten. Auch das „Gasthaus Schneeweiß” war von diesem Wandel betroffen. Es wurde bis 2000/01 von verschiedenen Betreiber·innen als klassisches Gasthaus geführt und anschließend bis zu seiner endgültigen Schließung im Jahr 2012 überwiegend als Caféhaus weiterbetrieben. Damit endete eine lange Epoche eines Hauses, das über Jahrzehnte ein Sinnbild für Gastlichkeit und gesellschaftliches Leben im Steirischen Wechselland dargestellt hatte.
Rettung vor der Zerstörung
Das Bundesdenkmalamt erwog den Schneeweißpavillon unter Denkmalschutz zu stellen, letztlich kam es jedoch nicht zu einer entsprechenden Unterschutzstellung. Der Unternehmer Werner Stögerer (1954–2017), der von 1990 bis 2005 als Vizebürgermeister der Marktgemeinde Pinggau tätig war, erwarb das ehemalige „Gasthaus Schneeweiß” samt Grundstück. Trotz einigen Widerstands der früheren Besitzer (Claudia Koller und Brigitte Holzer) wurden 2014 die dort befindlichen Bäume gefällt, die Gebäude abgetragen und das Gelände eingeebnet, um Platz für ein künftiges Wohnbauprojekt zu schaffen, das aber letztlich nie umgesetzt wurde (Stand 2025). Auch der Schneeweißpavillon sollte ursprünglich abgerissen werden. Doch Franz „Frank” Riegler (geb. 1960) aus Friedberg konnte den Eigentümer überzeugen, selbst das Gebäude sorgfältig abzutragen und zu erhalten – in der Hoffnung, ihn später an einem anderen Ort wieder aufbauen zu können. In leeren Räumlichkeiten der ehemaligen Thonet-Fabrik in Friedberg, in dem zwischen 1962 und 2006 Sesseln und Möbel hergestellt wurden, konnten die zerlegten Elemente des Schneeweißpavillons zwischengelagert werden.
Neuerrichtung im Rahmen des LEADER-Projektes „Erlebnisberg Friedberg“

Franz „Frank” Riegler machte den Autor und Obmann des Historischen Vereins Wechselland im Jahr 2015 darauf aufmerksam, dass er am Areal des Kriegerdenkmals (Besitz Stadtgemeinde Friedberg) – dem ehemaligen Standort der Burg Friedberg – einige Keramikfunde entdeckt hatte.
Nach Kontaktaufnahme mit dem Bundesdenkmalamt und dem Universalmuseum Joanneum fanden in den Jahren 2015 und 2016 mehrere Treffen statt. Es gelang, die Stadtgemeinde Friedberg von einer archäologischen Untersuchung des Areals zu überzeugen. Diese erfolgte 2017 und 2018 im Rahmen einer Arbeitsmarktinitiative – einer Kooperation zwischen der SöDieB GmbH (Sozialökonomische Dienstnehmerbetreuungs-GmbH), dem AMS Hartberg und der Stadtgemeinde Friedberg – unter der Leitung des Grazer Archäologen Federico Bellitti. Im Herbst 2018 wurde das Umfeld der Grabung zusätzlich geophysikalisch untersucht. Dadurch konnte erstmals die Dimension der mittelalterlichen Burg Friedberg sowie des späteren Doppelschlosses Friedberg genauer bestimmt werden. In der Folge war es nun möglich, das untersuchte Areal im Rahmen eines LEADER-Projekts zu attraktivieren. Dabei wurden auch zahlreiche Anregungen aus der Bevölkerung berücksichtigt – viele davon stammten von Franz Riegler selbst, etwa die Errichtung eines Aussichtsturms oder die Wiedererrichtung des Schneeweißpavillons. In enger Abstimmung mit den Anrainer·innen, dem Bundesdenkmalamt und der Stadtgemeinde Friedberg wurde in den Jahren 2019 bis 2021 das LEADER-Projekt „Erlebnisberg Friedberg” sowie ein begleitendes Infrastrukturprojekt umgesetzt. Im Zuge dessen entstanden unter anderem der Aussichtsturm „BERG:FRIED:BERG”, ein Themenspielplatz „Burg Friedberg” sowie ein Hochzeitspavillon am Standort der ehemaligen Burg. Parallel dazu erfolgte – im Rahmen der touristischen Weiterentwicklung des Steirischen Wechsellands – die Positionierung der Stadtgemeinde Friedberg als „Historische Stadt Friedberg”. Dieses Konzept basiert auf den Ideen des Autors und umfasst unter anderem ein neues Stadtführungskonzept.
Im Zuge des LEADER-Projekts war auch die Revitalisierung des abgetragenen Schneeweißpavillons vorgesehen. Das zunächst geplante Vorhaben, den Pavillon am Erlebnisberg Friedberg zu errichten, konnte jedoch aufgrund von Einwänden des Bundesdenkmalamts sowie von Anrainer·innen nicht umgesetzt werden. Daher begann die Suche nach einem alternativen Standort im Ortszentrum von Friedberg. Nach Abstimmungen mit Pfarrer Christoph Grabner, Propst Bernhard Mayrhofer (Stift Vorau), Leo Schneemann (Vorsitzender des Wirtschaftsrats der Pfarre Friedberg), Baumeister Gottfried Grimm, Bürgermeister Wolfgang Zingl, Silvia Hudin (Bundesdenkmalamt) sowie dem Autor als Projektumsetzer konnte schließlich ein passender Platz auf dem Kirchgrund bei der Stadtpfarrkirche Friedberg gefunden werden, der den Vorstellungen aller Beteiligten entsprach. Der Kirchgrund gehört zur Pfarre Friedberg, hinter der sich der dem Stift Vorau zugehörige Pfarrhof befindet. Die Stadtgemeinde Friedberg erhielt von der Pfarre die Zustimmung zur Errichtung des Pavillons, der nun in das Eigentum der Stadtgemeinde übergegangen ist. Zwar äußerte das Bundesdenkmalamt anfangs Bedenken, ein Jugendstilbauwerk zwischen der romanischen, später gotisch und barock erweiterten Stadtpfarrkirche und dem Pfarrhof aus dem späten 17. Jahrhundert zu errichten, doch konnte letztlich eine harmonische Lösung gefunden werden, die sowohl den denkmalpflegerischen als auch den städtebaulichen Ansprüchen gerecht wird.
Da das Areal unter Denkmalschutz steht – es befand sich dort bis 1863 der ehemalige Friedhof –, musste der geplante Standort für das Betonfundament zuvor archäologisch untersucht werden. Diese Untersuchung wurde erneut von Federico Bellitti durchgeführt. In enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt erfolgte anschließend im Sommer und Herbst 2020 die Restaurierung des Schneeweißpavillons durch die Friedberger Möbeltischlerei Ernst Ertl, die mit der Revitalisierung beauftragt war. Im Spätherbst 2020 bzw. Winter 2020/21 wurde der Pavillon schließlich am neuen Standort auf dem Kirchgrund wiederaufgebaut. Ein Großteil der originalen Holzkonstruktion sowie Teile der historischen Verglasung konnten dabei erhalten und wiederverwendet werden.
Der Schneeweißpavillon bietet nun die Möglichkeit, flexibel gestaltbare Ausstellungselemente zu beherbergen, die verschiedene Aspekte der Friedberger Stadtgeschichte präsentieren. Aktuell werden darin Informationen zum Künstler Josef Schneeweiß (1913–1990) sowie zum ehemaligen Friedberger Stadtpfarrer und Historiker Aquilin Julius Caesar (1720–1792) gezeigt. Im Austausch mit der Stadtgemeinde Friedberg ist bereits ein drittes Ausstellungselement in Planung, das die bestehende Präsentation thematisch erweitern soll. – In Folge soll kurz auf die beiden genannten Persönlichkeiten eingegangen werden.
Ausstellungselement zu Josef Schneeweiß (1913–1990)

Josef Schneeweiß wuchs im elterlichen „Gasthaus Schneeweiß” auf, das später von einer seiner beiden Schwestern weitergeführt wurde. Nach der Matura an der Lehrerbildungsanstalt in Graz im Jahr 1934, wo er Schüler des Künstlers Franz Zack (1884–1945) war, unterrichtete er von 1935 bis 1939 als Dorfschullehrer in Schölbing und Dechantskirchen. Bereits ab 1930 entstanden zahlreiche Aquarelle mit Motiven aus Pinggau, Friedberg und dem Steirischen Wechselland. 1939 wurde Schneeweiß zum Militärdienst eingezogen und nahm als Soldat unter anderem an den Feldzügen in Norwegen und in der Sowjetunion teil. Aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft kehrte er 1946 nach Österreich zurück und begann im selben Jahr ein Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, wo er bis 1950 unter anderem von Josef Dobrowsky (1899–1964) geprägt wurde. Nach Abschluss seines Studiums unterrichtete Schneeweiß bis zu seiner Pensionierung 1973 am Grazer Pestalozzi-Gymnasium. Seine Lehrtätigkeit wurde durch mehrere längere Auslandsaufenthalte unterbrochen: 1958–1960 am Internationalen Institut Monte Rosa in Montreux (Schweiz), 1962/63 am St.-Georgs-Kolleg in Istanbul (Türkei) sowie 1967 im Rahmen einer Studienreise nach Brasilien. In der Türkei unternahm er zahlreiche Exkursionen in das anatolische Hochland und nach Kappadokien, wo er unter anderem die heutige Welterbestätte Göreme besuchte. 1967 bereiste er – auf den Spuren des Wiener Landschaftsmalers Thomas Ender (1793–1875) – Brasilien, darunter Rio de Janeiro, Belo Horizonte und die damals neu errichtete Hauptstadt Brasília. Die Eindrücke dieser Reisen hielt er in Skizzen und Aquarellen fest, die später Eingang in sein künstlerisches Werk, aber auch Erzählungen und Schriften fanden.
Schließlich kehrte Josef Schneeweiß zu seinen Wurzeln in das Wechselland zurück. Bereits 1952, als die Stadt Friedberg die 700-jährige Nennung als Stadt (1252) feierte, wurden seine Bilder ausgestellt und gewürdigt. Nach dem Ausscheiden aus dem Lehrerdienst bereiste Josef Schneeweiß 1977 den italienisch-sprachigen Kanton Tessin in der Schweiz, von dem er gern bei geselligen Gesprächen, auch im Schneeweißpavillon, berichtete. Dutzende Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen folgten bis in die 1980er-Jahre. Seine Werke wurden auch im Ausland präsentiert, u. a. 1959 in Lausannne, 1967 in Rio de Janeiro und 1983 in Istanbul. 1976 wurde dem Künstler das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen und 1989 das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Friedberg. Josef Schneeweiß war mehrmals pro Monat im Steirischen Wechselland, wohnte aber in Graz, wo er am 9. April 1990 starb. Sein testamentarischer Wunsch ging 1994 in Erfüllung, als im Rahmen der Feier zur 800-jährigen Gründung (1194) von Friedberg im Thonet-Museum eine eigene Ausstellung sein Schaffen zeigte. Die hunderten Werke von Josef Schneeweiß befinden sich heute im Besitz vieler verschiedener Institutionen, wie der Wiener Albertina, oder in der Hand privater Sammler. In vielen Gaststuben des Steirischen Wechsellandes, im Stadtamt Friedberg, im Marktgemeindeamt Pinggau und in vielen Pfarrhöfen hängen seine Werke oder Kopien davon.[6]
Der Kunsthistoriker Georg Lechner beschreibt Josef Schneeweiß als einen vielseitigen Künstler, dessen umfangreiches Werk Malerei, Aquarelle, Grafiken und Radierungen umfasst. Sein künstlerischer Stil entwickelte sich von frühen, vom Kubismus beeinflussten Ansätzen hin zu einem „Phantastischen Realismus”, geprägt von feiner, beinahe magisch-realistischer Detailgenauigkeit und einer charakteristischen Lichtführung. Schneeweiß verband in seinen Arbeiten alltägliche Motive mit symbolischer Tiefe – Licht, Schatten und Reflexion spielten dabei stets eine zentrale gestalterische Rolle.[8]
Eine Auswahl seiner Werke, in enger Abstimmung mit Claudia Koller, der Großnichte des Künstlers, ist nun dauerhaft im Rahmen der Präsentation im Schneeweißpavillon zu besichtigen.
Ausstellungselement zu Aquilin Julius Caesar (1721–1792)

Das zweite Ausstellungselement wird durch eine lebensgroße Illustration zu Leben und Wirken von Aquilin Julius Caesar geprägt. Es versteht sich zugleich als Würdigung seiner Leistungen und seiner Bedeutung für die Stadtgeschichte von Friedberg. Ergänzend bietet die Präsentation einen Überblick über die Pfarrgeschichte von Friedberg sowie über die Bau- und Kunstgeschichte der Stadtpfarrkirche.
Ab etwa 1750 widmete sich Caesar neben der Theologie intensiv historischen und kirchenrechtlichen Studien. Ab 1754 begann er mit der Abfassung mehrerer Werke, die als die Grundlagen der steirischen Geschichtsschreibung gelten. In einer Zeit, in der die Geschichtswissenschaft in der Steiermark noch kaum etabliert war, setzte Caesar mit seinen Forschungen neue Maßstäbe.
Als überzeugter Anhänger der Aufklärung engagierte er sich für Reformen im Sinne von Vernunft und Wissenschaft. Während der Klosteraufhebungen unter Kaiser Joseph II. (1782/83) setzte er sich erfolgreich für den Erhalt des Stiftes Vorau ein. Ein ihm 1781 angebotenes Lehramt an der Universität Graz lehnte er ab, um seine Studien fortzusetzen. Während seiner Friedberger Jahre verfasste Caesar den Großteil seiner Werke. Seine sorgfältige Quellenarbeit führte dazu, dass zahlreiche Urkunden, historische Informationen und Überlieferungen – auch zur Stadtgeschichte Friedbergs – dadurch erhalten blieben. Mit seiner systematischen Bearbeitung der steirischen Geschichte gilt er als Begründer der steirischen Landesgeschichtsschreibung. Seine Hauptwerke – die „Annales ducatus Styriae” (1768–1777, vier Bände), die „Beschreibung des Herzogthums Steyermark” (1773, zwei Bände) sowie die „Staat- und Kirchengeschichte des Herzogthums Steyermarks” (1786–1788, sieben Bände) – erschienen in beachtlichen Auflagen und galten über Jahrzehnte hinweg als Standardwerke der steirischen Geschichtsschreibung. Erst Albert von Muchar (1786–1849) setzte mit seiner mehrbändigen Geschichte der Steiermark (1844–1874) Caesars Arbeit in vergleichbarer Breite fort.
Viele von Caesars Schriften blieben ungedruckt und sind heute verloren. Dennoch prägt sein Werk bis heute das historische Verständnis der Steiermark. Posthum erhielt er den Ehrentitel „Historiae Patriae Pater” bzw. „Vater der steirischen Landesgeschichtsschreibung”. Ohne seine Forschungen wären viele Kapitel der Friedberger und steirischen Geschichte unwiederbringlich verloren. Die für Friedberg wahrscheinlich wichtigste Urkunde konnte Aquilin Julius Caesar 1786/88 noch sichten und abschreiben; diese befand sich im Stiftsarchiv Vorau, gilt seitdem jedoch als verschollen. Darin werden 1252 erstmals die Burg Friedberg, die Stadt sowie die Pfarre Friedberg genannt. Gäbe es diese Abschrift nicht, wäre eine Einordnung der Geschichte von Friedberg für das Hochmittelalter kaum zu leisten.
Resümée
Da die Ausstellungselemente modular gestaltet und leicht zu entfernen sind, kann der Schneeweißpavillon zusätzlich für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden: etwa für kirchliche Agapen, Fotoshootings bei Hochzeiten, lokale Fotoausstellungen, das Adventzauber-Konzert (Firma E.L.T.), Buchpräsentationen oder Lesungen. Darüber hinaus stellt der Schneeweißpavillon einen festen Bestandteil der Stadtführungen zur Geschichte Friedbergs dar. Als offizielle Bezeichnung innerhalb dieser Führungen sowie als Ortsangabe bei Veranstaltungen, etwa im Rahmen der Adventkonzerte, wird – entsprechend dem Vorschlag des Autors im Zuge der Projektumsetzung – die Bezeichnung „Schneeweißpavillon” verwendet.
Der Schneeweißpavillon stellt somit heute ein bedeutendes Element der kulturhistorischen Infrastruktur der Stadt Friedberg dar. Durch seine Einbindung in das Projekt „Erlebnisberg Friedberg” sowie in das Konzept der „Historischen Stadt Friedberg” erfüllt er eine doppelte Funktion: einerseits als Objekt der Denkmalpflege und musealen Vermittlung, andererseits als flexibel nutzbarer Ort für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen. Damit leistet der Pavillon einen Beitrag zur nachhaltigen Bewahrung, Erforschung und Präsentation der lokalen Geschichte und dokumentiert zugleich den erfolgreichen Umgang mit baukulturellem Erbe im ländlichen Raum der Steiermark.[9]
Literatur
- Gottfried Allmer, Gemeinde Pinggau. Geschichte und Kultur im oststeirischen Wechselland (Pinggau 2013).
- Ferdinand Hutz, 800 Jahre Stadt Friedberg. 1194–1994 (Hausmannstätten 1994).
- Jenni Koller, Josef Schneeweiß (Oberwart 2022).
- Thomas Kühtreiber/Andreas Salmhofer, Neue Erkenntnisse zur Burg Friedberg. In: Steinpeißer 29 (Hartberg 2022), 32–45.
- Helmut J. Mezler-Andelberg, Aquilin Julius Caesar und die Anfänge der steirischen Landesgeschichtsschreibung. In: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 57 (1966), 27–58.
- Andreas Salmhofer/Ernst Hofer u. a., Von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Die Geschichte des Wechsellandes. Band 1 (Überarbeitete Neuauflage, Friedberg 2024).
- Andreas Salmhofer/Kerstin Ziegler u. a., Von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Die Geschichte des Wechsellandes. Band 2 (Friedberg 2023).
- Andreas Salmhofer, Schulungsunterlagen zur Stadtführung Friedberg (unveröffentl. Manuskript, Friedberg 2022).
- Josef Schneeweiß, Ein Maler erzählt. Beilage zum Ausstellungskatalog (Graz 1983).
Anmerkungen
* Ein Beitrag zur Bau-, Sozial- und Kulturgeschichte des Steirischen Wechsellandes vom frühen 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart.
[1] Vgl. Andreas Salmhofer/Ernst Hofer u. a., Von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Die Geschichte des Wechsellandes. Band 1 (überarbeitete Neuauflage, Friedberg 2024), 92f.
[2] Die Schreibweise des Familiennamens variiert vielfach in den Unterlagen oder Werbeunterlagen, meistens wird aber die Version mit „ß" verwendet.
[3] Vgl. Gottfried Allmer, Gemeinde Pinggau. Geschichte und Kultur im oststeirischen Wechselland (Pinggau 2013), 83, 217.
[4] Vgl. Radiointerview (Radio Steiermark) 1985 mit Prof. Josef Schneeweiß, ab Minute 18. Archiv Historischer Verein Wechselland.
[5] Vgl. Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus dem Steirischen Wechselland, Archiv Historischer Verein Wechselland. Sämtliche Informationen aus etwa 170 Interviews (2014-2025) werden von Andreas Salmhofer und Kerstin Ziegler in den nächsten Jahren publiziert.
[6] Vgl. Radiointerview (Radio Steiermark) 1985 mit Prof. Josef Schneeweiß, ab Minute 18. Archiv Historischer Verein Wechselland.
[7] Vgl. Andreas Salmhofer, Schulungsunterlagen zur Stadtführung Friedberg (unveröffentl. Manuskript, Friedberg 2022), 93–98.
[8] Vgl. Jenni Koller, Josef Schneeweiß (Oberwart 2022), 5–7.
[9] Der Autor dankt herzlich Ewald Grill, Rupert Gruber, Brigitte Holzer, Silvia Hudin, Claudia Koller, Jenni Koller, Georg Lechner, Karl Mathä, Ulrike Riebenbauer, Franz Riegler, Erich Strobl und Wolfgang Zingl für ihre wertvollen Auskünfte und Hinweise in den vergangenen Jahren, die maßgeblich zur Erstellung dieses Textes beigetragen haben.
Mag. Dr. Andreas Salmhofer, geboren 1978, studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wiener Institut für sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik (WISDOM) und ist derzeit an der Forschungsstelle der KZ-Gedenkstätte Mauthausen tätig. Zudem gehört er dem Redaktionsteam des Open-Access-Journals „coMMents – chronicle of the Mauthausen Memorial: current studies” an. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Zeitgeschichte sowie in der Regionalgeschichte des Wechsellands, die er epochenübergreifend erforscht. Seit 2014 leitet er als Obmann den  Historischen Verein Wechselland. 2024 wurde er zum Korrespondenten der Historischen Landeskommission für Steiermark (HLK) für den Bereich „Steirisches Wechselland” bestellt. Darüber hinaus initiierte und setzte er drei LEADER-Projekte um, die maßgeblich zur historischen und kulturellen Aufwertung der Region beitrugen, namentlich die Initiativen „Kräuterregion Wechselland”, „Historischer Weitwanderweg Wechselland” und „Erlebnisberg Friedberg”.
Historischen Verein Wechselland. 2024 wurde er zum Korrespondenten der Historischen Landeskommission für Steiermark (HLK) für den Bereich „Steirisches Wechselland” bestellt. Darüber hinaus initiierte und setzte er drei LEADER-Projekte um, die maßgeblich zur historischen und kulturellen Aufwertung der Region beitrugen, namentlich die Initiativen „Kräuterregion Wechselland”, „Historischer Weitwanderweg Wechselland” und „Erlebnisberg Friedberg”.